 WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist einer der bekanntesten politischen Gefangenen unserer Zeit. Seit elf Jahren interniert, feiert er am 3. Juli 2021 als »Untersuchungsgefangener« seinen 50. Geburtstag im britischen Hochsicherheitsgefängnis. Wer sich näher mit der Geschichte seiner Verfolgung befassen möchte, liest den spektakulären Report des UNO-Sonderberichterstatters für Folter, Nils Melzer, der jetzt in Buchform vorliegt. Weiterlesen
WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist einer der bekanntesten politischen Gefangenen unserer Zeit. Seit elf Jahren interniert, feiert er am 3. Juli 2021 als »Untersuchungsgefangener« seinen 50. Geburtstag im britischen Hochsicherheitsgefängnis. Wer sich näher mit der Geschichte seiner Verfolgung befassen möchte, liest den spektakulären Report des UNO-Sonderberichterstatters für Folter, Nils Melzer, der jetzt in Buchform vorliegt. Weiterlesen
Archiv
Der Fall Julian Assange. Geschichte einer Verfolgung
Ingrid Caven
 Ein Lächeln
Ein Lächeln
Als ‹Callas des europäischen Kabaretts› wurde Ingrid Fassbinder bezeichnet, die unter dem Künstlernamen «Ingrid Caven» als Schauspielerin und Sängerin in dem Roman gleichen Namens von Jean-Jacques Schuhl im Mittelpunkt steht. Der bis dato kaum bekannte, französische Schriftsteller, der vierundzwanzig Jahre lang kein Buch mehr veröffentlicht hatte, landete mit dem Roman über die Frau, mit der er seit Jahrzehnten zusammenlebt, einen Riesenerfolg, das Buch bekam den Prix Goncourt 2000. Es sind viele Geschichten, die in diesem Roman erzählt werden, nicht nur die einer in Frankreich überaus erfolgreichen, an Marlene Dietrich erinnernden Diseuse, sondern auch die von Fassbinder, Yves Saint Laurent und unzähligen anderen Prominenten aus Kunst und Kultur.
Ingrid hat am Heiligabend 1943 schon als Vierjährige ihren ersten Bühnen-Auftritt, als Sängerin von Weihnachts-Liedern vor Soldaten der Wehrmacht. Im Hause ihres Großvaters gab es, wie sie sich erinnert, «Musik in allen Stockwerken», die Familie war musikalisch geprägt. Als sie an die Musik-Hochschule nach München geht, wird sie von Rainer Werner Fassbinder entdeckt, macht mehrere Filme mit ihm und heiratet ihn 1970. Die Ehe mit dem homosexuellen Filmemacher wurde nach zwei Jahren wieder geschieden, 1978 ging sie dann nach Paris und begann dort eine zweite, sehr erfolgreiche Karriere als Chanson-Sängerin. Ihr Lebenspartner dort ist der Autor selbst, der in seinem Roman in der dritten Person als Charles auftritt und abwechselnd mit seiner als Ich-Erzählerin fungierenden Protagonistin deren Leben schildert. Das geschieht weder in chronologischer Folge noch einigermaßen vollständig, sondern bruchstückhaft, ganze Lebensbereiche werden ausgeblendet. Dafür ist das Erzählte reichlich mit peripheren politischen Ereignissen, dem Kunstgeschehen in aller Welt, mit Klatsch und Tratsch über Prominente aus der internationalen Presse angereichert.
Jean-Jacques Schuhl beschäftigt sich intensiv mit der Bühnenwirkung dieser Künstlerin. Deren Präsenz im Rampenlicht, deren ebenso subtile wie zwingende Bühnensprache ist durch eine nur ihr eigene, für sie typische Gestik geprägt. Gleiches gilt für ihre vielseitige Gesangskunst, die vom trivialen Schlager bis zur avantgardistischen Musik eines Arnold Schönberg einen weiten Bogen umfasst. Seine literarisch als Collage angelegte Huldigung gibt dem Autor jedoch immer wieder Rätsel auf. Ingrid Caven wird in Frankreich als würdige Nachfolgerin von Marlene Dietrich angesehen, obwohl ihr nicht die großen Posen der Diva zu eigen sind. Sie erscheint im Gegenteil völlig unprätentiös und ist eher für ihre strenge Disziplin als Künstlerin bekannt. Bei der Ausschmückung dieser Lebensgeschichte kommt der Autor oft gehörig vom Wege ab und verliert sich im Anekdotischen. Er bereichert damit allerdings seine Geschichte auch mit viel Zeitkolorit und gestaltet sie fast schon wie eine künstlerische und gesellschaftliche Odyssee. Neben München und Paris ist es vor allem New York, wo sich das Paar häufig aufhält, Ingrid ihre Auftritte hat und sie beide auf großem Fuß leben.
Neben vielen kontemplativen Einschüben erfreut der Roman durch eine reichhaltige Intertextualität, da kommt dem Leser plötzlich schon mal Leopold Bloom entgegen. Es gibt aber auch viele Alltagssprüche, Redensarten, Kinderlieder und Songtexte in Englisch und Französisch, die dieser unaufgeregt und diskret erzählten Geschichte Authentizität verleihen. Er habe sich für unfähig gehalten, «die Magie dieses Musik gewordenen Körpers» in Worte zu fassen, hat der Autor bescheiden angemerkt. Besonders berührend ist gegen Ende ein rätselhaftes Blatt Papier, das neben Fassbinders Leiche gefunden wurde. Auf dem hatte er handschriftlich das Leben von Ingrid Caven, über den Tag hinaus bis zu ihrem Tod, stichwortartig aufgeschrieben. Der letzte Punkt lautet: «Streit Schlägerei Liebe Hass Glück Tränen Tabletten Tod + ein Lächeln». Es kam anders, sie tritt bis in jüngste Zeit immer noch auf!
Fazit: erfreulich
Meine Website: http://ortaia.de
Verirrungen
 Impressionistisch hingetupft
Impressionistisch hingetupft
Der 1895 erschienene Roman des schwedischen Schriftstellers Hjalmar Söderberg erschien unter dem Titel «Verirrungen» 2006 in neuer deutscher Übersetzung. Er gehört zu dem Mitte des 19ten Jahrhunderts von Edgar Allen Poe begründeten Genre des Flaneur-Romans und löste im prüden Fin de Siècle einen Skandal aus als «eine der unkeuschesten Hervorbringungen» der schwedischen Literatur, wie es in dem berühmten Verriss von Harald Molander hieß. Er sprach von «Dekadenzformen der niedrigeren Triebe des Menschen, ungezügelt, aber doch gleichzeitig ohnmächtig, Leidenschaften von wirklicher Intensität zu gebären».
Der Flaneur dieses Romans heißt Tomas, zwanzig Jahre alt, angehender Arzt, aus gutem Hause stammend, ein charmanter Tunichtgut mit Erfolg bei den Frauen, sein Flanierareal liegt im Herzen Stockholms. Gleich zu Beginn begegnen wir ihm nach dem Kauf roter Handschuhe, eine Alibihandlung, denn in Wirklichkeit geht es ihm um die nette Verkäuferin in dem Handschuh-Laden, die er bezaubernd findet. Bei einem Dinner trifft er wenig später die Gymnasiastin Märta, in die er schon länger verliebt ist und die er sich als seine künftige Frau vorstellen könnte. Söderberg nutzt das Dinner sehr geschickt für eine scharfsichtige Analyse der damaligen Stockholmer Bourgeoisie mit allen ihren Brüchen, wobei der Seelenzustand seiner Figuren hier nicht psychologisch analysiert wird, sondern sich allein durch ihr Handeln und ihre Äußerungen offenbart. Beide Mädchen erliegen schon bald dem Charme von Tomas. Neben der Liebe ist auch permanenter Geldmangel ein vordringliches Thema, der Vater von Tomas hält ihn eher knapp. Sein dekadentes Lotterleben aber ist teuer, und so gerät er schließlich in die Fänge eines Wucherers, mit dessen Hilfe er naiv seine diversen Schulden loszuwerden hofft.
Diese motivischen Verknüpfungen sind mit feiner Ironie und ganz ohne Pathos kühl und distanziert in einen Plot eingewoben, der erst ab der Mitte ein Minimum an Spannung erhält. Weite Strecken des Romans sind nämlich durch minutiöse Schilderungen dessen bestimmt, was Tomas als Flaneur auf seinen Streifzügen durch immer die gleichen Straßen an immer den gleichen Orten erlebt. Insoweit ist diese Hommage für das literarische Genre typisch, Stockholm-Kenner werden ihre helle Freude daran haben, ist doch diese Metropole von den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs verschont geblieben und strahlt noch den Charme vergangener Epochen aus. Mit feinem Gespür für Details schildert Hjalmar Söderberg ebenso eindringlich immer wieder die Natur und benutzt gekonnt das Wetter als stimmungsmäßige Grundierung des Geschehens, ohne dabei je in naturalistische Schwärmerei abzugleiten.
Dieser die verlogenen Konventionen einer dekadenten bürgerlichen Gesellschaft anprangernde Roman gehört heute zu den Klassikern der schwedischen Literatur. Sprachlich federleicht werden die titelgebenden «Verirrungen» des antriebslosen Protagonisten realistisch und nüchtern geschildert, ohne moralistische Wertung also. Als Tagträumer irrt Tomas so lange unentschieden zwischen den beiden Mädchen hin und her, bis ihm das Heft des Handelns endgültig entglitten ist. Er wird als ein Getriebener und Gefangener gleichzeitig dargestellt, der sich zuweilen elegisch selbst bedauert, dann aber auch wieder lebensfroh neuen Mut schöpft. Der Autor arbeitet in seinem klug anlegten Plot mit allerlei Leitmotivik und Farbsymbolik, mit raffiniert eingebauten, insignifikant erscheinenden Szenen wie dem taumelnden Hochzeitsflug zweier Schmetterlinge oder andere nebensächliche Beobachtungen, die seine Motive gleichwohl vorausdeuten oder begleitend illustrieren. Ein gutes Beispiel dafür ist die im Dinner-Kapitel vage angedeutete Verbundenheit zwischen der Mutter von Tomas und dem Konsul, der am Ende dann plötzlich auftaucht und kommentarlos die Schulden des Hallodris begleicht. Derart impressionistisch hingetupften Kontext übersieht man leicht, man sollte sich also Zeit lassen zur genüsslichen Lektüre.
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
Dunkle Gesellschaft
 Im Bann der Untoten
Im Bann der Untoten
Die «Dunkle Gesellschaft», ein «Roman in zehn Regennächten», wie es im Untertitel heißt, nimmt im vielseitigen Œuvre von Gert Loschütz durch seine virtuose Erzähltechnik eine Sonderrolle ein. Es ist ein Erinnerungsroman, der in zehn Kapiteln aus dem bewegten Leben eines Binnenschiffers erzählt, dem in jeder Episode immer wieder die schwarz gekleideten Männer und Frauen mit weißen Gesichtern begegnen. Vor diesen Gestalten hatte ihn schon sein Großvater gewarnt, weil sie Unglück bedeuten.
Der alleinstehende Ich-Erzähler Thomas hat sich nach dem Verlust seines Patents für Fluss- und Küstenmotorschiffe resigniert in die ländliche Einsamkeit der niedersächsischen Provinz zurückgezogen. Die ungewohnte Ereignislosigkeit auf dem flachen Lande jedoch treibt den ruhelosen Mann, der die längste Zeit seines Lebens an Bord verbracht und auch immer nur am Wasser gewohnt hat, in schlaflosen Nächten zu langen Spaziergängen aus dem Haus, bei Wind und Wetter. Dabei erinnert er sich an mysteriöse Begebenheiten in seinem unsteten Leben zurück, in denen die «Dunkle Gesellschaft» der Schwarzgekleideten jeweils bevorstehendes Unheil symbolisiert, – Menschen verschwinden spurlos, Morde geschehen, Unglücke und Katastrophen ereignen sich. Ebenso symbolisch bildet der pausenlose, allmählich sintflutartig anschwellende Regen bei all diesen Episoden den Hintergrund. Er bringt dem lebenslang mit diesem Element Verbundenen das Wasser zurück in sein binnenländisches Refugium und vertreibt ihn schließlich nach zehntägiger Dauer, als Opfer einer verheerenden Überschwemmung, fluchtartig wieder von dort.
Geradezu symptomatisch beginnen die Erinnerungen während der Ausbildung von Thomas auf dem Naval College mit der Geschichte von einem Geisterschiff auf der Themse. Er erzählt ferner von seinen mysteriösen Erlebnissen als Schlafwagenschaffner, von undurchsichtigen Ereignissen auf einem Schloss und von einem geheimnisvollen Verwechslungsspiel um den vermeintlichen, messiasähnlichen Erlöser einer Geheimgesellschaft von Flagellanten. Mit Katharina kommt eine rätselhafte Frau ins Spiel, deren Eltern eine große Sammlung historischer Rechenmaschinen besitzen, sie will ihn durch ein selbstgestochenes Tattoo an sich binden. Auf seinem Laptop erscheint plötzlich beim Einschalten die anonyme, orakelhafte Nachricht «Null vierzig», ein merkwürdiger Junge hält Thomas für seinen Vater und verfolgt ihn. Beim wetterbedingten, unfreiwilligen Stopp im Wiener Hafen Albern gerät er zufällig in eine Live-Sexshow und trifft in einer Werkstatt auf eine seltsame Frau, die Opfer eines für Freitag angekündigten Mordes wird. In der letzten Geschichte hat er eine aufs rein Sexuelle reduzierte Affäre mit der Frau des Nachbarn, der offensichtlich einverstanden ist und heimlich voyeuristisch partizipiert. Als Thomas schließlich wegen der Überflutungen evakuiert wird, ist auch dieses Nachbarpaar im Bus und steigt am Ziel zögernd in einen anderen Bus mit schwarzen Scheiben um, der rasch davonfährt.
Die disparaten Motive dieses Romans erlauben keine stimmige Deutung, gemeinsames Merkmal ist ihre unheilschwangere Atmosphäre, die das rätselhafte, düstere Geschehen permanent mit einer geradezu albtraumhaften Spannung auflädt. In dieser finsteren Welt tauchen als geisterhafte Figuren immer wieder Schattengestalten oder Wiedergänger auf, die das phantastische Geschehen für den Leser vollends undurchschaubar machen. Anders als beim Erzählstil des magischen Realismus fehlt hier jedwede rationale Grundlage. Gert Loschütz benutzt eine unprätentiöse, klare Sprache für seine oft unscharfen, manchmal lose verbundenen Traumbilder, die fragmentarisch die Erfahrungen seines Protagonisten schildern, ohne sie in einen nachvollziehbaren Zusammenhang zu bringen oder gar zu deuten. Das also bleibt dem Leser selbst überlassen, – falls der sich nicht lieber ganz einfach dem Rausch der Bilder in seinem Kopfkino überlässt, die ihm einige anregende Stunden im Bann der Untoten bescheren.
Fazit: erfreulich
Meine Website: http://ortaia.de
Der Tätowierer von Auschwitz
 Am 23. April 1942 trifft der 25-jährige Ludwig Eisenberg aus Krompachy, Slowakei, in einem verschlossenen Viehtransporter im Konzentrationslager Auschwitz ein. Sein Verbrechen: Er ist Jude. Der junge Mann hat keine Ahnung, welcher Horror ihn in den nächsten zweieinhalb Jahren in der Tötungsfabrik erwarten wird, in der rund 1,5 Millionen Leidensgenossen aus aller Herren Länder ihr Leben lassen. Doch der Junge überlebt den Holocaust, den Auschwitz symbolisiert. Ein halbes Jahrhundert später vertraut er sich der australischen Autorin Heather Morris in Melbourne an, die seine Erlebnisse unter dem Titel „Der Tätowierer von Auschwitz“ literarisch verdichtet und damit einen Weltbestseller schafft. Weiterlesen
Am 23. April 1942 trifft der 25-jährige Ludwig Eisenberg aus Krompachy, Slowakei, in einem verschlossenen Viehtransporter im Konzentrationslager Auschwitz ein. Sein Verbrechen: Er ist Jude. Der junge Mann hat keine Ahnung, welcher Horror ihn in den nächsten zweieinhalb Jahren in der Tötungsfabrik erwarten wird, in der rund 1,5 Millionen Leidensgenossen aus aller Herren Länder ihr Leben lassen. Doch der Junge überlebt den Holocaust, den Auschwitz symbolisiert. Ein halbes Jahrhundert später vertraut er sich der australischen Autorin Heather Morris in Melbourne an, die seine Erlebnisse unter dem Titel „Der Tätowierer von Auschwitz“ literarisch verdichtet und damit einen Weltbestseller schafft. Weiterlesen
Der Eissturm
 Eiskalte Schlüsselparty
Eiskalte Schlüsselparty
Im eher bescheidenen Œuvre des US-amerikanischen Schriftstellers Rick Moody ist «Der Eissturm», 1994 erschienen, sein bekanntestes Werk. Der Stoff wurde schon drei Jahre später verfilmt, produziert als Independent-Film und prominent besetzt. Wie es der Zufall will, hatte ich gestern gerade den Roman fertig gelesen, da entdeckte ich, dass der Film abends auf «Arte» läuft, – so konnte ich also Buch und Film direkt vergleichen. Mir fiel auf, dass der Spielfilm sehr dicht an die Vorlage angelehnt ist, und er hat mir auch deutlich besser gefallen als der Roman. Was mir als überzeugtem Buchleser, der seine Bilder allemal lieber selber im Kopf erzeugt, so noch nie vorgekommen ist.
Handlungszeit ist das Wochenende von Thanksgiving im Jahre 1973, Handlungsort ist die Kleinstadt New Canaan im Bundesstaat Connecticut, eine der reichsten Städte der USA. Das Wetter ist äußerst garstig, ein heftiger Eissturm verbreitet überall Chaos. Es ist die Zeit der Watergate-Affäre, die materiell privilegierten Romanfiguren verkörpern geradezu archetypisch den American Way of Life, sind aber gleichwohl im Innersten unzufrieden. Ihren Frust versuchen sie durch sexuelle Libertinage zu kompensieren, die sexuelle Revolution in Europa ist auch auf die prüden USA übergeschwappt. «Dann will ich Ihnen mal die Komödie über diese Familie servieren, die ich in meiner Jugend gekannt habe» lautet etwas holperig der erste Satz, und weiter: «Auch für mich gibt’s eine Rolle in der Geschichte – die gibt’s für ein Klatschmaul immer –, aber dazu später mehr». Und dann lässt sich das Klatschmaul in epischer Breite über den Sex aus, Joachim Kaiser hat es einst überaus treffend so formuliert: «Ich habe mich am Anfang beim Lesen so gefühlt, als wenn ich im Theater sitze und da sind lauter nackte Leute auf der Bühne.» Petting, Onanie, Sperma, Koitus, Defloration, Impotenz, Ehebruch sind die Themen, die scheinbar, – glaubt man dem Autor -, die frustrierten US-amerikanischen Wohlstandsbürger jener Zeit vorwiegend beschäftigen, gipfelnd in dem lustigen neuen Gesellschaftsspiel namens «Schlüsselparty», das Rick Moody mit diesem Roman als erster in die Populärkultur eingeführt hat.
Es geht um die Familie Hood, deren Leben nach diesem Wochenende nicht mehr das gleiche ist wie vorher. Während der 40jährige Ben mit der flotten Nachbarin Janey, deren Ehemann Jim häufig auf Geschäftsreise ist, ein intimes Verhältnis hat und seine gelangweilte Frau Elena ihren Frust durch Kleptomanie kompensiert, versucht sich ihr introvertierter Sohn Paul, das Alter Ego des Autors, erfolglos an eine Mitschülerin heranzumachen. Seine vorlaute Schwester Wendy animiert Sandy, den zehnjährigen Sohn von Janey, zu Doktorspielen, nachdem sie schon dessen älteren Bruder Mickey verführt hat. Erwähnt sei noch, dass Janey sich beim Schlüsselspiel statt Ben den jüngsten Party-Teilnehmer angelt und die gehemmte Elena ausgerechnet Jim, den Mann von Bens nachbarlichem Betthäschen Janey, beim Griff in die Schlüsselschale «gewinnt». Sie lässt sich auch gleich im Auto von ihm vernaschen, als Rache quasi, – völlig freudlos allerdings, Ejaculatio praecox heißt das Stichwort dazu. Und auch ihr Ben geht leer aus, er liegt volltrunken im Badezimmer der Party-Villa.
Was thematisch an Schnitzler erinnert in diesem amerikanischen «Reigen», das ist hier allerdings primitivste Verbalerotik ohne jedes Raffinement, so kalt wie der titelgebende Eissturm. Das Ganze endet für alle im Fiasko, es gibt einen Toten und ein Hollywood-typisches Ende mit Pauls lächelnder Familie, als sie ihn nach einer Horrornacht im vereisten Zug glücklich am Bahnhof abholt. Indem der Film viele im Roman seitenlang abgehandelte, langweilige Details, vor allem über Pauls nervige, idiotische Comic-Hefte, gottlob weglässt und sich auf den seelischen Kern seiner Figuren konzentriert, vermag er diese zynische Abrechnung mit der gelangweilten Generation jener Zeit deutlich glaubhafter abzubilden.
Fazit: miserabel
Meine Website: http://ortaia.de
Gilles` Frau
 Unwiederbringlich
Unwiederbringlich
Im Jahre 1937 erschien der Roman «Gilles´ Frau» als Debüt der belgischen Schriftstellerin Madeleine Bourdouxhe – und blieb weitgehend unbeachtet. Zwölf Jahre später ging Simone de Beauvoir dann in ihrem berühmten Buch «Das andere Geschlecht» ausführlich auf die Thematik in Bourdouxhes Roman ein, der die Diskrepanzen weiblicher und männlicher Sexualität in fiktionaler Form aufzeigt. Wiederentdeckt, und durch diverse Übersetzungen weithin bekannt, wurde er erst 1985, von der Kritik in Frankreich damals als makelloses Debüt gefeiert. Ein Klassiker also, der den heutigen Leser eventuell irritieren wird mit seiner feministischen Problematik, über die inzwischen zwar die Zeit hinweg gegangen ist, deren Grundbedingungen aber als genetische Prägung ja nach wie vor gelten dürften.
Der Arbeiter Gilles, ein äußerst stattlicher, kräftiger Mann, und seine attraktive, ebenso fleißige wie brave Ehefrau Elisa leben mit ihren kleinen Zwillingstöchtern glücklich und zufrieden in einer belgischen Industriestadt, – Lüttich vermutlich, der Name wird nicht genannt. Ihre auch sexuell beglückende Zweisamkeit in einer rundum harmonischen Ehe wird abrupt gestört, als es Elisas jüngerer Schwester Victorine gelingt, Gilles zu verführen. Schlagartig wird er ihr regelrecht hörig und gesteht nach einiger Zeit schließlich seiner bereits etwas Derartiges ahnenden Frau diese rauschartige, leidenschaftliche Affäre. Elisas Lebensglück, ihr Daseinszweck gar besteht darin, «Gilles´ Frau» zu sein, nicht nur juristisch, sondern auch sexuell, etwas anderes kann sie sich mit ihrem schlichten Gemüt beim besten Willen nicht vorstellen. Sie hofft nun inständig darauf, dass er sich irgendwann aus seiner fatalen, rein triebgesteuerten Abhängigkeit wird lösen können, und lebt fortan unfreiwillig in einer Ménage-à-trois, – eine Demütigung, die sie geduldig hinnimmt. Nach außen hin ändert sich nichts, sie erwartet ihr drittes Kind, der untreue Gilles bleibt bei ihr wohnen und kümmert sich nach wie vor um Frau und Kinder, trifft sich aber sehr oft zum Sex mit der lasziven Victorine. Als die jedoch plötzlich verkündet, einen anderen Mann heiraten zu wollen, rastet der eifersüchtige Gilles in seiner primitiven Männlichkeit total aus und schlägt sie grün und blau. Allmählich gelingt es ihm dann zwar doch, sich aus seiner sexuellen Obsession zu lösen, aber seine Liebe zu Elisa lebt nicht wieder auf. Er ist ziemlich lethargisch geworden und hat jegliches Interesse an ihr verloren. Elisa ist fassungslos, ihr Glück ist endgültig zerstört!
Dieser Roman trägt alle Züge einer antiken Tragödie, geradezu paradigmatisch wird hier der gescheiterte Versuch einer einfachen Frau ohne ausgeprägte eigene Identität geschildert, den aus ihrer schon beinahe symbiotischen Ehe ausgebrochenen Mann zurück zu gewinnen, egal wie. Beide Protagonisten dieser fast ausschließlich auf sie fokussierten, kammerspielartig aufgebauten Geschichte scheitern. Gilles scheitert an der Amour fou mit seiner leichtlebigen Schwägerin, Elisa an der nun endgültig erloschenen Liebe ihres Mannes, – Fontane hat seinen thematisch vergleichbaren Roman sehr treffend «Unwiederbringlich« betitelt, – mit einem ebenso katharsisähnlichen Ende übrigens.
Es ist die schicksalhafte Vorbestimmung, die das Geschehen in diesem Roman schon bei der Schilderung der ehelichen Idylle von Anfang an drohend überlagert, zu schön um wahr zu sein, quasi. Wobei Madeleine Bourdouxhe mit ihrer zurückgenommenen, schlichten Sprache komplexe, emotionale Vorgänge extrem komprimiert zu veranschaulichen versteht. Wozu ist die zerstörerische Kraft einer bedingungslosen Liebe fähig? «Die Auslöschung der eigenen Person im Namen der Liebe – das ist mehr oder weniger die Geschichte aller Frauen» hat die Autorin einst in einem Kommentar zu ihrem Roman kurz und bündig festgestellt. Und wenn man dieses Buch gelesen hat, dann ist man fast geneigt, ihr das tatsächlich auch zu glauben.
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
Hysteria
 Nicht mal «Die Grünen»
Nicht mal «Die Grünen»
Für Auszüge aus seinem Romanprojekt «Hysteria» wurde Eckhart Nickel schon beim Bachmannpreis 2017 in Klagenfurt ausgezeichnet, inzwischen ist das Werk auf die Shortlist des diesjährigen Deutschen Buchpreises gewählt worden. Damit hat die Jury erneut viel Mut bewiesen – und deutlich am Publikumsgeschmack vorbei entschieden, vermute ich mal. Es sei denn, die «neu an die Macht gekommene Naturpartei» im Roman wird als fiktive Fortschreibung der jüngsten, triumphalen Wahlergebnisse der «Grünen» gedeutet und passt somit prophetisch bestens in die politische Realität, – das wäre dann aber hier auch das einzig Reale! Denn schon der Romantitel deutet ja an, dass es sich um eine Dystopie handelt, ein pessimistischer Blick in eine ungute Zukunft also á la Orwells «1984» oder «Fahrenheit 451»von Ray Bradbury.
«Mit den Himbeeren stimmte etwas nicht» lautet denn auch archetypisch vorausdeutend gleich der erste Satz, der hypersensible Wissenschaftler Bergheim wundert sich über die unnatürliche Beschaffenheit seiner auf dem Biomarkt erworbenen Früchte. Auf dem Obstkörbchen ist «Sommerfrische» aufgedruckt, der Name des Lieferanten, den er daraufhin aufsucht. Dort wird er freundlich zu einer Werksführung eingeladen, wandert im Kapitel «Baumschule» durch einen unheimlichen Wald und landet schließlich im «Kulinarischen Institut», dem alles beherrschenden Zentrum einer mehr als merkwürdigen Welt alternativer Lebensmittel. Dort trifft er Charlotte wieder, seine ehemalige Studienkollegin und Geliebte, die dort Leiterin der Bewegung «Spurenloses Leben» ist, einem aus ihrer Hochschule hervorgegangen Geheimbund mit einem monströsen Manifest von zehn unumstößlichen Regeln. Und auch Ansgar, Dritter im Bunde des einstigen Uni-Kleeblatts, taucht dort wieder auf und hilft letztendlich, das Schlimmste zu verhindern. In bester popliterarischer Tradition führt der Autor seine Leser in eine unheimliche Zukunft hinein, in der die Natur von den auch als «Rousseau-Husaren» bezeichneten Mitgliedern der radikalen Sekte komplett durch Kunstprodukte ersetzt ist, ohne dass die Öffentlichkeit auch nur das Geringste davon gemerkt hat. Köstlich ist in diesem Zusammenhang die sarkastische Schilderung eines Besuchs des studentischen Trios in der «Aroma-Bar», in der diese neuzeitliche, illusionäre Kulinarik geradezu seanceartig ad absurdum geführt wird.
«Tristesse Royal» hieß der Titel eines Buches, in dem die Quintessenz der Gespräche des «Popkulturellen Quintetts» im Berliner Hotel Adlon, an denen Eckhart Nickel als Mitglied teilgenommen hatte, 1999 veröffentlicht wurde. Entsprechend subversiv dem Zeitgeist entgegentretend, dem Gutmenschentum mit seinem naiv verklärten Naturbegriff also, beschreibt der Autor nun in diesem Ökothriller ein monströses, geradezu perverses Szenario des Künftigen. Die unverkennbar ironisch geschilderten, oftmals aber eher unerquicklichen Science-Fiction-Szenen des Romans werden durch weiträumige, ebenso ironische Rückblenden wohltuend konterkariert, in denen das Studententrio tiefsinnige Diskussionen führt. Dabei spielt ein idealtypisches Antiquariat mit einem kauzigen Buchhändler eine wichtige Rolle, in dem Bergheim als Stammkunde verkehrt und wo auch Charlotte als Aushilfe tätig ist. Nur diese literarische Oase macht, im Verbund mit einer reichhaltigen Intertextualität in einem ansonsten von Paranoia dominierten Horrortrip, das Buch für alle diesem speziellen Genre eher distanziert gegenüber stehenden Leser überhaupt erst goutierbar.
Die in zwei Zeitebenen beschriebene, satirische Dystopie changiert geradezu parodistisch zwischen den manchmal schwer auseinander zu haltenden Sphären von Traum, Wahn und Wirklichkeit, die angestrebte Renaturalisierung erweist sich hier nicht nur als grausames, sondern auch als ebenso irres Vorhaben. Wer nicht gerade Genreleser ist, der wird an dieser Spielart des «Zurück zur Natur» jedoch kaum Gefallen finden, – nicht mal «Die Grünen» der Jetztzeit, zu abstrus ist das alles!
Fazit: miserabel
Meine Website: http://ortaia.de
Weitlings Sommerfrische
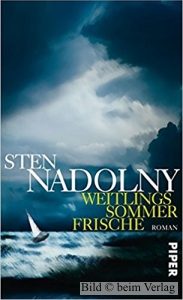 Multiple Identität
Multiple Identität
In seinem verschiedentlich als Alterswerk apostrophiertem Roman «Weitlings Sommerfrische» beleuchtet Sten Nadolny das Problem menschlicher Identität mit Hilfe einer Zeitreise, hier sogar in beiden möglichen Varianten, zurück und voraus. Die Identität aber, um die es sich konkret handelt, die des Protagonisten dieser Geschichte, ist so stark autobiografisch inspiriert, dass sich unwillkürlich die Frage aufdrängt, ob die vom Autor gewählte Form der philosophischen Zeitreise in beide Richtungen für die Aufarbeitung der eigenen Biografie und für den beabsichtigten Erkenntnisgewinn beim Leser wirklich optimal ist.
In den ersten beiden der neun Kapitel dieser Geschichte berichtet ein auktorialer Erzähler von dem pensionierten Richter Dr. Wilhelm Weitling aus Berlin, der am Chiemsee in einem angemieteten Sommerhaus den wohlverdienten Ruhestand genießt. Bei einem Segeltörn mit seiner Plätte, einem zum Segelboot umgebauten Fischerkahn, gerät er in einen Sturm und kentert, ein Blitz schlägt in seiner Nähe ein. Im dritten Kapitel wechselt abrupt die Erzählperspektive, der sechzehnjährige Willy wird 1958 mit seinem manövrierunfähigen Boot im Sturm an das Ostufer des Chiemsees getrieben. «Wenn es Gott gäbe, hätte er bei dieser Rettung die Hand im Spiel gehabt». Der das denkt ist aber nicht Willy, «sondern nach wie vor der alte Mann aus Berlin, aber für andere unsichtbar, Geist ohne Physis, gekettet an einen Sechzehnjährigen aus Stöttham bei Chieming». Das Trauma durch den Blitz hat Weitling in die Vergangenheit zurückgeschleudert.
Was folgt ist eine Zeitreise an der Seite von Willy als Pennäler, den er unsichtbar mehrere Monate lang durch sein Leben begleitet und dabei wieder auf seine Eltern trifft, auf seine Jugendliebe. Er kann aber keinen Kontakt zu ihnen aufnehmen und bleibt passiver Beobachter des Geschehens. Mit der Zeit weicht Willys Leben von Weitlings Erinnerung immer mehr ab, besonders gravierend erscheint dabei dessen Berufswahl, denn Willy will Schriftsteller werden, nicht Volljurist. Als Weitling glaubt, im Chiemsee die goldene Patrone gefunden zu haben, mit der General Patton 1945 persönlich den Führer erschießen wollte, die ihm aber dort aus der Hosentasche gefallen war und im See versunken ist, worauf hin er wütend in den See uriniert habe, da befördert das ungestüme Lachen über diese kuriose Anekdote Weitling wieder in die Gegenwart. Zu seinem Erstaunen aber in die abweichende Vita von Willy, er ist nicht mehr Richter und kinderlos, sondern Schriftsteller und inzwischen sogar Großvater, seine Identität hat sich geändert. Als zwei Jahre nach seiner Rückkehr aus der Vergangenheit seine Enkelin ihm nachts als Geist erscheint, als 68Jährige aus dem Jahr 2072 in die Gegenwart des Jahres 2012 zurückgekehrt, unterlässt er es bewusst, sie über die Zukunft auszufragen.
Nadolny erzählt seine phantastische Geschichte mit ihrem komplizierten Szenario in einem ruhigen, fast schon betulichen Ton mit einfach strukturierten Sätzen. Derart bedächtig, als wolle er «Die Entdeckung der Langsamkeit», den Titel seines erfolgreichsten Romans also, hier stilistisch tatsächlich mal realisieren. Das gemächliche Tempo des Plots nimmt gegen Ende geringfügig an Fahrt auf, ohne je thrillerartig zu werden, wobei die rätselhafte Geschichte über eine multiple Persönlichkeit durchaus selbstkritisch und mit unterschwelliger Ironie erzählt wird. Man kann diese «Versuchsanordnung» zur eigenen Identität, wie Nadolny selbst sie bezeichnet hat, als angenehm uneitle Autobiografie lesen, in der er mehr oder weniger sinnreiche philosophische Einsprengsel aus seiner eigenen Gedankenwelt verarbeitet hat. Der große Lesegenuss wollte sich bei mir trotz allem aber nicht einstellen, zu absurd, zu verkopft empfand ich diese Geschichte, zu wenige Emotionen weckend oder gar Empathie aufbauend. Zeitreise und multiple Identität als Vehikel einer Autobiografie zu benutzen erscheint mir nach dieser Lektüre tatsächlich suboptimal.
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de
Tabu
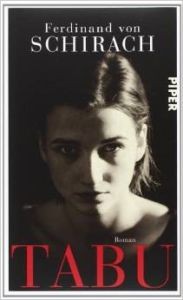 Nomen est omen
Nomen est omen
Als Senkrechtstarter der deutschen Literaturszene hat Ferdinand von Schirach mit «Tabu» einen Roman vorgelegt, an dem sich die Geister scheiden. Monatelanger Bestsellerstatus und große Breitenwirkung auch im Ausland taugen mitnichten als Indiz für gute Literatur, und so mischt sich in den Chor der Jubel-Rezensenten denn auch prompt manche kritische Stimme, literarisch sei «noch reichlich Luft nach oben», urteilt beispielsweise die FAZ. Die Hassliebe des deutschen Feuilletons polarisiert sich in der hymnischen Rezension im «Spiegel» und dem gnadenlosen Verriss der «ZEIT». Was stimmt denn nun?
Letzteres, sage ich, der ich unwissend zu diesem Roman gegriffen habe, weder seine Thematik kennend noch die konträren Rezensionen oder gar ein anderes Werk des gefeierten Autors. Dieses Buch, war mein für mich ziemlich überraschendes Fazit, ist gründlich danebengelungen, und zwar aus vielerlei Gründen. Beginnen wir bei der Handlung, die grotesk unwirklich ist, zu abstrus, um hier komplett darüber zu berichten, auf einige wenige Einzelheiten will ich dennoch eingehen. Erzählt wird die Lebensgeschichte von Sebastian Eschburg, aus verarmtem «guten Hause» stammend, mit lieblosen Eltern, von Synästhesie betroffen, jahrelang Internatszögling. Anschließend Lehre als Fotograf, der dann in Rekordzeit ein weltweit gefeierter Künstler wird. Im zweiten Teil wechselt die Handlung abrupt, ein knorriger alter Rechtsanwalt übernimmt die Verteidigung des wegen Mordes angeklagten Protagonisten. All das wird in kurzen, präzise formulierten Sätzen nüchtern, geradezu «sachdienlich» erzählt, Schlag auf Schlag die Fakten aneinanderreihend und damit den Plot vorantreibend in einem selten so ausgeprägt zu erlebenden, komprimierten Text. Wer es sprachlich absolut schnörkellos mag, wird jubeln. Gar nicht schnörkellos hingegen ist der Plot selbst, man wundert sich über viele Abschweifungen, die dem Geschehen rein gar nichts hinzufügen, die eher falsche Erwartungen wecken wie das Nietzsche-Haus in Sils Maria mit seinen geraniengeschmückten Fenstern, um nur ein Beispiel zu nennen. Farblos bleiben auch die meisten Figuren, sie wirken gefühlsarm und ziemlich unsympathisch, allenfalls der Verteidiger vermag Empathie zu wecken beim Leser.
Zweifel sind angebracht, ob der anonyme Telefonanruf eines vermeintlichen Entführungsopfers und ein unter Folterandrohung erlangtes Geständnis tatsächlich einen Mordprozess ohne Leiche, – die einer unbekannten Frau obendrein, auszulösen vermag. Absurd auch die ausufernde Befragung des vernehmenden Polizisten über seine Einstellung zur Folter, ist doch aktenkundig und steht also von vornherein fest, dass so ein Geständnis gar nicht verwertbar ist. Fiktion des Autors? Oder denkbare Realität, ist er doch selbst Strafverteidiger, dessen Kompetenz ja wohl außer Frage steht. Fragwürdig, um nicht zu sagen geradezu lächerlich, ist auch das ins Pornografische abgleitende, bis dato größte Werk des gefeierten Künstlers mit dem Titel «Sofias Männer», für das Goyas Zwillingsgemälde «Die nackte Maja» und «Die bekleidete Maja» die Idee geliefert haben. Auf Eschburgs Foto ist seine Freundin Sofia nackt und 16 Männer in Anzügen stehen um sie herum und starrten sie an. «Auf dem zweiten Bild trug Sofia die Kleider der Maja. Die Männer standen so wie auf dem ersten Bild, aber jetzt waren sie nackt. Mit der gleichen Kopfhaltung starrten sie Sofia an, ihre Schwänze waren steif, sie zeigten auf das Gesicht und auf den Körper Sofias. Zwei der Männer hatten ihr Sperma auf Sofias Bluse gespritzt». Was will uns der Autor damit sagen? Und natürlich wird dieses grandiose Kunstwerk sogleich an einen Japaner verkauft, «du bist jetzt reich», sagt Sofia dazu. Es gibt dergleichen Peinliches mehr in diesem Buch, mancherlei philosophisches Geschwafel und psychologische Plattheiten obendrein, allzu viel ist inkonsistent und reichlich irritierend.
Mit minimalistischen Hauptsätzen als Werkzeug malt man literarisch kein hinreißendes Ölbild wie das der nackten Maja, eher die hastige Entwurfsskizze eines Frauenakts. Dementsprechend wirkt dieser Roman mit seiner verworrenen Geschichte, deren tieferer Sinn sich wohl nur der geistigen Elite unter den Lesern zu erschließen vermag, stilistisch freudlos, bar jeder Emotion, garantiert humorfrei außerdem. Wer eine erfreuliche, eine bereichernde Lektüre schätzt, dem sei geraten, den nebulösen Buchtitel hier mal ganz wörtlich zu interpretieren, frei nach Plautus: «nomen est omen».
Fazit: miserabel
Meine Website: http://ortaia.de
Der Cembalospieler
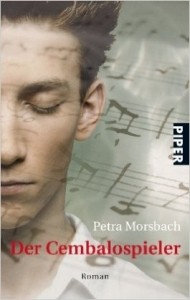 Weniger wäre mehr gewesen
Weniger wäre mehr gewesen
Man kann der Schriftstellerin Petra Morsbach nicht vorwerfen, dass sie sich auf ein Lieblingssujet konzentriert in ihren Romanen, ihr Interesse richtet sich auf unterschiedlichste Stoffe. Mit «Der Cembalospieler» hat sie sich der Alten Musik zugewandt, wobei sie zu gedanklichen Höhenflügen abhebt, die dem in der Musiktheorie und –geschichte weniger bewanderten Normalleser deutlich seine Grenzen aufzeigt, ihn häufig kaum noch folgen lässt bei feinsinnigen Analysen hochkomplexer Kompositionen, – für fachlich kompetentere Leser andererseits sicherlich ein willkommener Streifzug durch ein elitäres Spezialgebiet klassischer Musik.
Felix Bauer, der Ich-Erzähler, entdeckt mit fünf Jahren seine Liebe zum Klavier, spielt schon nach wenigen Tagen erstaunlich gut, ein typisches Wunderkind. Er stammt aus prekären Verhältnissen, der Vater ist Trinker und verlässt die Familie, die Mutter zermürbt die beiden Söhne mit permanenten Anschuldigungen, sie ist der personifizierte Vorwurf, eine im Dauerfrust lebende Frau, die sich durch die Söhne ein Ventil zum Frustabbau verschafft. Das Dauerfeuer an Vorhaltungen treibt Felix von frühester Jugend an, – neben seinem sowieso grenzenlos scheinenden Enthusiasmus -, ebenfalls in die Gefilde der Musik. Er durchläuft die übliche Wunderkindkarriere mit Höchstleistungen auf allen Gebieten, findet durch glücklichen Zufall zum Cembalo, seiner großen Liebe, die sein ganzes Leben dominieren wird bis zum Ende der Karriere. Bald gibt er die ersten Konzerte, wird zum gefeierten Star an seinem Instrument, arbeitet am Konservatorium in Salzburg, erfreut sich der Gunst vieler Mäzene, die ihn nach Kräften fördern. Schnell wird er in prominente Künstlerkreise aufgenommen, kann sich sein sündteures Traum-Cembalo bauen lassen.
Als er zehn Jahre alt war, wurde bei ihm eine unheilbare Netzhauterkrankung diagnostiziert, die die Sehfähigkeit bald auf wenige Prozent herabsetzen wird. Als junger Mann schließlich bemerkte er seine homosexuelle Orientierung, die ihm neben seiner einseitig der Musik gewidmeten Lebensplanung und dem Versinken in die dunkle Welt des weitgehend Blinden auch noch eine geschlechtliche Außenseiterrolle zudiktiert. Sein System sozialer Beziehungen ist deshalb mehr als kümmerlich entwickelt, er lebt zumeist allein in einer winzigen Wohnung in München, sein Privatleben besteht zu großen Teilen aus Üben für das nächste Konzert, aus Cembalounterricht oder der Vorbereitung von Fachvorträgen. Als er jenseits der Vierzig ist, erlischt allmählich das Interesse des Publikums an Alter Musik und am Cembalo als Instrument, die Mäzene ziehen sich zurück; der Absturz in prekäre finanzielle Verhältnisse steht ihm bevor, darüber ist er sich illusionslos im Klaren.
In fünf Kapitel unterteilt erzählt die Autorin in zwei alternierenden Zeitebenen, durch normale und kursive Schrift leicht unterscheidbar, abwechselnd von Vorbereitungen des Superstars auf lukrative Privatkonzerte und vom Lebensweg ihres Protagonisten. Beide Handlungsebenen münden in eine fatale Zukunftsperspektive für das einstige Wunderkind. Die schlichte, humorlos ernste Sprache bietet keine literarischen Höhenflüge, sie vermittelt zweckgerichtet und schnörkellos die Lebensgeschichte eines Hochbegabten, damit einerseits an den «Doktor Faustus» von Thomas Mann erinnernd, vor allem aber an «Der Untergeher» von Thomas Bernhard. Die Tragik des Genies, seine Zwanghaftigkeit, die Defizite im Menschlichen, der zerstörerische Kunstbetrieb, all dies erscheint mir hier sehr klischeehaft erzählt, die so selbstsicher demonstrierte Fachkompetenz ist mir verdächtig, zumindest aber hinterfragbar, ein Adorno wie beim «Doktor Faustus» wird jedenfalls nicht benannt. Weniger wäre mehr gewesen, meine ich, der Plot mit seinem blinden, schwulen Wunderkind trägt deutlich zu dick auf, er verprellt zudem mit seinem musiktheoretischen Fachchinesisch eher, als dass er unterhält oder den Leser wirklich bereichert.
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de
Der Allesforscher
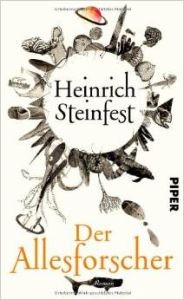 Weniger wäre mehr gewesen
Weniger wäre mehr gewesen
Surreales in Prosa zu übertragen scheint das spezielle Anliegen von Heinrich Steinfest zu sein, dessen Roman «Der Allesforscher» es unter die Finalisten des Buchpreises 2014 geschafft hat. Im Vergleich zu den fünf anderen Werken der Endrunde von Sujet und Stil her eine saloppe, populistische Prosa, die sich beim Leser anbiedert gleich von den ersten Zeilen an, und die ihn dann nicht mehr loslässt bis zum Epilog. Wen wundert’s auch bei einem Autor, der viele erfolgreiche Krimis geschrieben hat! Im Unterschied zum magischen Realismus als literarischer Form allerdings sprechen bei Steinfest keine Tiere, sie explodieren allenfalls wie der Pottwal gleich zu Beginn. Die Handlung bleibt durchweg realistisch, im Bereich des Möglichen also, Überirdisches ist in diverse Traumsequenzen ausgelagert, die gegen Ende des Buches dann einen ziemlich breiten Raum einnehmen.
Sixten Braun, der Held der Erzählung, erfolgreicher IT-Manager auf Geschäftsreise, wird nach einem aberwitzigen Unfall auf Taiwan von Dr. Lana Senft behandelt, man kommt sich auch privat näher. Auf dem Rückflug von Japan stürzt seine Maschine ab, er überlebt, kehrt nach Deutschland zurück, heiratet seine Verlobte und tritt in deren Vaters Firma ein, wird aber schon zwei Jahre später wieder geschieden. Er sattelt beruflich um und wird Bademeister. Eines Tages erreicht ihn ein Anruf der taiwanesischen Vertretung, er erfährt, dass Lana gestorben ist und einen Sohn hinterlassen hat, dessen Vater er vermutlich sei. Der siebenjährige Junge hat zwar unverkennbar chinesisches Aussehen, er adoptiert ihn trotzdem. Simon ist autistisch, ist einerseits ein hervorragender Kletterer und ebenso guter Zeichner, spricht aber in einer von niemandem verstandenen Sprache und ist auch nicht in der Lage, neue Wörter zu lernen, die Kommunikation mit ihm bleibt auf Gesten beschränkt. Kerstin, die Angestellte in der Vertretung Taiwans, und Sixten beginnen schon bald eine Beziehung, sie zieht bei ihm ein und kümmert sich ebenfalls um Simon.
In einem eingeschobenen Nebenstrang wird die Geschichte des Chinesen Auden Cheng erzählt, einem erfolgreichen Hersteller exklusiver Kosmetikprodukte, der sich mannhaft gegen mafiöse Übernahmeversuche großer Konzerne wehrt, nach einem bewaffneten Überfall aber plötzlich die Gefahr sehr ernst nimmt und abtaucht, eine neue Identität annimmt und alle Spuren hinter sich verwischt. Er hatte längere Zeit ein Verhältnis mit der Ärztin Lana, bis Sixten auftauchte. Beim Showdown in der Bergwelt Tirols, bei einem gemeinsamen Ausflug zu dem Gipfel, an dem Sixtens Schwester beim Bergsteigen ihr Leben verlor, treffen die beiden Liebhaber Lanas schließlich aufeinander, ohne voneinander zu wissen, und der Autor belässt es auch dabei.
Logik ist kein Kriterium, das Steinfest bremst in seiner im freundschaftlichen Plauderton erzählten, sprachlich verspielten Geschichte mit ihren geradezu hanebüchenen Wendungen. Er reiht slapstickartig groteske Bilder aneinander, erfindet immer irrwitzigere Szenerien, all das garniert mit wohlfeiler Alltagsphilosophie, die nicht selten ins Banale abgleitet. Eine unkonventionelle Sicht auf die Welt und ihre scheinbaren Realitäten ist prinzipiell ja durchaus bereichernd und wird von mir als Leser auch freudig goutiert, erscheint hier aber allzu aberwitzig konstruiert. Dieses literarische Konstrukt erreicht seinen peinlichen Höhepunkt in den unsäglichen Traumgeschichten, die mich ebenso gestört haben wie der hymnische Alpinismus am Ende der Geschichte. Mit seinem fast lakonischen Duktus ist dem Autor der ambitionierte Versuch, von ihm erdachte extreme Situationen und seltsam skurrile Figuren in einen realistisch erzählten Plot einzubauen, grandios danebengelungen. Das nervt regelrecht mit zunehmender Lesezeit, weniger wäre hier wirklich mehr gewesen, schade eigentlich!
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de
Die Möwe
 Es glimmt doch noch
Es glimmt doch noch
«Die Glut ist erloschen» wurde im Feuilleton getitelt über den 1948 erschienenen Roman »Die Möwe» von Sándor Márai, damit hinweisend auf dessen sechs Jahre vorher entstandenen, wahrlich grandiosen Roman «Die Glut». Man findet in beiden Werken die für diesen ungarischen Schriftsteller typischen literarischen Stilmittel, als da wären: Eine kammerspielartige Szenerie, eine gescheiterte Liebe als schicksalhafte Thematik, weit ausholende, melancholische Reflexionen, oft ins Monologische abdriftende, lange Dialoge, geheimnisumwehte, rätselhaft bleibende Protagonisten, und auch der Tod ist immer dabei als thematisches Grundelement.
Ein namenlos bleibender Ministerialrat in Budapest fertigt ein wichtiges geheimes Dokument aus, das erst am nächsten Tage veröffentlich werden soll. Dessen Inhalt bleibt zwar ungenannt im Roman, alles deutet aber darauf hin, dass es sich um eine militärische Aktion Ungarns im Fortgang des Zweiten Weltkriegs handelt. Als ihn in seinem Büro eine schöne junge Frau mit einer Empfehlung eines seiner Bekannten aufsucht, hat er ein Déjà-vu-Erlebnis. Er erkennt in ihr seine ehemalige Geliebte Ilona, die sich einst aus unerklärlichen Gründen mit Blausäure das Leben genommen hat, – die Ähnlichkeit jedenfalls ist frappant! Diese Reinkarnation Ilonas ist eine finnische Lehrerin, die fließend mehrere Sprachen spricht und ihn um eine Arbeitserlaubnis für Ungarn ersucht. En passant thematisiert Marais hier also auch das Phänomen der finno-ugrischen Sprachenfamilie, die Finnin spricht perfekt Ungarisch. Spontan lädt der Mann die Frau für den Abend in die Oper ein, genießt die Aufmerksamkeit, die die ebenso schöne wie elegante Frau in seiner staatlichen Opernloge beim neugierigen Publikum erregt, anschließend gehen sie noch auf einen Kaffee in seine Wohnung. Zu dem Kaffee kommt es aber nicht, die Beiden beginnen ein schier endloses, tiefgründiges Gespräch, irgendwann küsst er sie spontan. Es bleibt bei diesem einen Kuss, sie duzen sich fortan, aber spät in der Nacht möchte sie gehen: «Öffne die Tür und entlasse mich auf meinen Weg». Und als er sie begleiten will: «Du weißt genau, […] dass es die größte, die einzige Höflichkeit ist, wenn du mich nicht begleitest. Ich sage es noch einmal, entlasse mich auf meinen Weg. Ich sage es deinetwegen und meinetwegen». Er bleibt allein zurück. Der letzte Satz des Romans lautet dann: «Er geht durch das Zimmer wie ein Blinder – und doch so, als führte ihn jemand».
Es ist ein intensiver Gedankenaustausch zwischen den beiden so ungleichen Menschen, die sich nicht kennen und die ein unwahrscheinlicher Zufall zusammengeführt hat vor dem historischen Hintergrund des Kampfes zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus in Europa. Diesen ideologischen Konflikt verdeutlicht die titelgebende Möwe, ein Vogel, der nur nach rechts und links sehen kann und nicht nach vorn, weil er keine Stirn hat mit Augen darin, den verbohrten Politikern damit ähnelnd. Aus dem Roman spricht die tiefe Resignation seines Autors angesichts der politischen Zustände jener Zeit, aber auch seine weitgehende Skepsis gegenüber dem Leben selbst. Die Sinnsuche ist das große Thema, das ihn umtreibt. Er beklagt zudem den tumben Massenmenschen als neues soziologisches Phänomen sowie den weit fortgeschrittenen moralischen Verfall der Gesellschaft.
Erzählt wird all das sehr eindringlich in einer wohlklingenden, dichten Sprache, wobei das zentrale Zwiegespräch einen großen Teil der Geschichte ausmacht. Die Dialoge werden oft durch innere Monologe des Ministerialrats ergänzt, häufiger noch wird in der Form des Bewusstseinsstroms erzählt. Der 1989 durch Suizid aus dem Leben geschiedene Autor verleiht mit seinem depressiven Duktus der Geschichte etwas Zwingendes, dem man sich kaum entziehen kann, so elementar ist die Thematik, die seine metaphernreiche Sprache dem geneigten Leser nahe zu bringen sucht. Die Glut seines literarischen Feuers glimmt also immer noch, auch in diesem tiefsinnigen Roman.
Fazit: erfreulich
Meine Website: http://ortaia.de
Himmel und Hölle
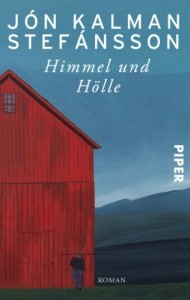 Ein verlorenes Paradies?
Ein verlorenes Paradies?
Bestimmt liegt es am Klima der Insel, an der rauen Umgebung, an den harten Lebensbedingungen im Island vor etwa hundert Jahren, dass Menschen zu solchen urigen Typen geformt werden, wie Jón Kalman Stefánsson sie uns in seinem Roman vorstellt, sehr eigen jedenfalls, unverwechselbar, wahre Unikate der menschlichen Spezies. Für mich liegt die Stärke dieses Romans in der meisterhaften Figurenzeichnung, mit der es dem Autor gelingt, uns seine vielen Charaktere glaubhaft nahe zu bringen, uns vor allem ihr Innerstes, ihre Gedankenwelt, ja geradezu ihre Seele zu präsentieren. Protagonist der Geschichte ist ein namenlos bleibender junger Mann, «der Junge», wie er im Roman genannt wird, Jüngster in einer Gruppe von sechs Fischern, die aus ihrem Fjord im offenen Holzboot auf Dorschfang ins Polarmeer hinausrudern.
Die Substantive des Buchtitels finden sich in umgekehrter Reihenfolge im Roman wieder, der Leser erlebt also zunächst die «Hölle» im ersten Teil der Geschichte. Es ist eine äußerst realistisch geschilderte Fahrt zum Fischen, beginnend beim Aufstehen der kleinen Mannschaft mitten in der Nacht, spannend und detailreich beschrieben, ein für heutige Menschen unvorstellbar hartes Gewerbe, mit geradezu archaischen anmutenden einfachen Mitteln betrieben, das kaum so viel einbringt, um davon sein karges Leben bestreiten zu können. Der enge Freund «des Jungen» kommt dabei ums Leben, weil er vor dem Ablegen des Bootes unbedingt noch einen Blick in John Miltons Hauptwerk «Das verlorene Paradies» werfen muss, dessen Verse ihn geradezu verzaubern. Und so vergisst er in seiner literarischen Begeisterung, seinen wetterfesten Anorak mitzunehmen, was ihn das Leben kosten wird, ein heranziehender Sturm mit Schnee und eisigen Winden wird ihm zu Verhängnis. Literatur kann also zuweilen auch tödlich sein, zumindest indirekt! Dieses Motiv wiederholt sich sogar, an anderer Stelle wird eine Frau beim Lesen eines Buches vom Tode überrascht. Nebenbei bemerkt ist für Bücherwürmer ja eigentlich kaum eine idealere Art denkbar, diese Welt zu verlassen, wenn’s denn unbedingt sein muss.
«Der Junge» macht sich umgehend auf, das verhängnisvolle, nur ausgeliehene Buch seinem Eigentümer, einem erblindeten Kapitän, zurück zu bringen, danach will er nicht mehr weiterleben. Er denkt nur noch an Selbstmord nach dem Verlust des Freundes. Bei seinem nächtlichen Gewaltmarsch zum Nachbarort entgeht er nur knapp dem Kältetod, ist zeitweise im Delirium, welches der Autor als kurzen philosophischen Einschub dem zweiten Teil der Geschichte voranstellt. Der dann eher als «Himmel» bezeichnet werden könnte nach den kargen Maßstäben für das menschliche Wohlergehen, die der Leser im ersten Teil kennen gelernt hat. Auch hier im Dorf begegnet man wieder vielen Originalen, amüsant beschriebenen Figuren aus dem prallen Leben jedenfalls, einer skurriler als der andere. «Der Junge» aber gewinnt seinen Lebensmut zurück in dieser neuen Umgebung, denn als Fischer wird er nie mehr arbeiten, soviel steht fest für ihn. Und auch sein erfrorener Freund entschwindet am Ende aus seinen Fieberträumen, er wird ihm nicht ins Totenreich folgen.
Stefánsson erzählt seine nur wenige Tage dauernde Geschichte in einer eminent metaphernreichen, oft auch lyrischen Sprache, die den Leser regelrecht mitschwimmen lässt in einem Strom wohlgesetzter Worte, häufig als innerer Monolog und in wechselnden Tempora erzählt. In vielen kleinen, kunstvoll ineinander verwoben Episoden werden uns quicklebendige Figuren vorgestellt, und die grandiose Landschaft Islands ist anschaulich und gekonnt überall mit einbezogen in den Plot. Der Roman ist ein intensives Leseerlebnis für Leser mit Sinn für solch ein fremdartig anmutendes, karges Milieu, – ein verlorenes Paradies?
Fazit: erfreulich
Meine Website: http://ortaia.de
Exit (Silo Band 3)
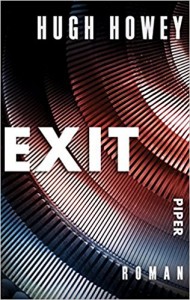 Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass das Schicksal aller in deinen Händen liegt? Juliette Nichols, die neue Herrin in Silo 18, bricht mit den jahrhundertealten Regeln der unterirdischen Gemeinschaft – und lässt den riesigen Bohrer demontieren, um ihn für einen neuen Zweck einzusetzen. Denn Juliette weiß, dass ihr Freund Lucas und die anderen sterben werden, wenn sie nicht sofort handelt. Doch sie weiß nicht, dass ihr die größte Überraschung noch bevorsteht…
Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass das Schicksal aller in deinen Händen liegt? Juliette Nichols, die neue Herrin in Silo 18, bricht mit den jahrhundertealten Regeln der unterirdischen Gemeinschaft – und lässt den riesigen Bohrer demontieren, um ihn für einen neuen Zweck einzusetzen. Denn Juliette weiß, dass ihr Freund Lucas und die anderen sterben werden, wenn sie nicht sofort handelt. Doch sie weiß nicht, dass ihr die größte Überraschung noch bevorsteht…
Der dritte und letzte Band der “Silo” Trilogie und ich fand ihn großartig!
Die Figuren aus Band 1 und 2 stehen jetzt im direkten Zusammenhang und teilweise auch in Kontakt und das Buch war super spannend.
Die Geschichte springt kapitelweise immer zwischen den Personen aus Band 1 und Band 2 hin und her und entwickelt sich rasant. Währen große Teile des zweiten Bandes einige Schwächen hatten (Langatmigkeit und für meinen Geschmack zu viele und zu detaillierte Hintergrundinformationen), so sind jetzt auch die Kapitel über die Figuren aus Band 2 sehr fesselnd und kurzweilig.
Über den Inhalt möchte gar nicht viel verraten, weil die Klappentexte eigentlich schon zu viel preisgegeben und man diese dringend meiden sollte, wenn man erst bei Band 1 ist!
Ich möchte aber zumindest sagen, dass in Band 3 noch einmal ganz andere Aspekte hinzukommen, z.b die Angst vor Veränderung und wie sich Gruppen unter Extrembedingungen spalten können und Menschen sich verändern, wenn es ums Überleben geht…
Das Ende hat mir auch sehr gut gefallen, es ist nicht zu offen (was bei sehr vielen Endzeitgeschichten der Fall ist) und auch nicht zu sehr “alles ist schön“. Ich persönlich würde mir auch noch einen vierten Teil wünschen, denn genug Stoff dafür gäbe es allemal. Aber dann wäre es wohl eine unendliche Geschichte…
Eine wirklich großartige Trilogie, mit einigen Schwächen im zweiten Band aber für Endzeitfans auf jeden Fall sehr zu empfehlen!