 Eva Siegmund liebt Barcelona. Unter dem geschickt gewählten Pseudonym Catalina Ferrera führt sie den Leser zu einigen ihrer Lieblingsplätze, informiert über kulturelle und soziale Hintergründe und vermittelt den Reiz der malerischen Stadt am Mittelmeer.
Eva Siegmund liebt Barcelona. Unter dem geschickt gewählten Pseudonym Catalina Ferrera führt sie den Leser zu einigen ihrer Lieblingsplätze, informiert über kulturelle und soziale Hintergründe und vermittelt den Reiz der malerischen Stadt am Mittelmeer.
Archiv
Spanische Delikatessen
Brick Lane
 Prekär wie die gleichnamige Straße
Prekär wie die gleichnamige Straße
Ihr Debütroman «Brick Lane» hat die britische Schriftstellerin Monica Ali auf einen Schlag berühmt gemacht, er wurde 2003 für den Booker Price nominiert und löste einen entsprechenden Hype aus, der sich in Deutschland allerdings nicht wiederholte, ganz im Gegenteil. Der 2007 verfilmte Roman wurde vom britischen Feuilleton positiv kommentiert, führte jedoch auch zu erregten Debatten, an denen sich sogar Salman Rushdie vehement beteiligte. Es ging dabei allerdings nicht um die literarische Qualität, sondern um seine Thematik, Immigration ist schließlich ja nicht nur in Großbritannien ein Reizthema par excellence. Die Autorin mit bengalischem Vater und englischer Mutter verdeutlicht schon mit dem Titel ihres Buches, worum es geht. Die reale Brick Lane in Londons East End, knapp zwei Kilometer lang, liegt in der prekären Gegend von ‹Tower Hamlets›, einer Art ‹Klein-Indien›, sie bildet den Mittelpunkt im Viertel der Immigranten aus Bangladesch.
Erzählt wird die Geschichte von Nazneen, die als 18jährige Bengalin von ihrem Vater mit dem zwanzig Jahre älteren, behäbigen Chanu verheiratet wird und aus einem kleinen Dorf in Bangladesch zu ihm nach London geht. Sie ist völlig ungebildet, kann kein Wort Englisch und ist in ihrer traditionellen Rolle als islamische Frau strikt an das Haus gebunden, sie verlässt die winzige, armselige Wohnung kaum. Wir haben es mit einem typischen Entwicklungsroman zu tun, der erste Satz lautet denn auch: «Eine Stunde und fünfundvierzig Minuten bevor Nazneens Leben begann – es begann, wie es für einige Zeit auch weitergehen sollte, das heißt ungewiss -, spürte ihre Mutter Rupban, wie eine eiserne Faust ihren Leib zusammenpresste.»
Im ersten Teil der Geschichte wird das armselige Leben Nazneens in Bangladesch beschrieben, aus dessen Fremdbestimmung sich ihre jüngere Schwester Hasina befreit, indem sie mit ihrem Geliebten in die Hauptstadt Dhaka durchbrennt, eine Auflehnung gegen die Eltern, die für Nazneen völlig undenkbar wäre. Ihr Mann ist gut zu ihr, erweist sich aber mit den Jahren als völlig unrealistischer Schwadroneur, er kündigt am Ende entmutigt seine Stellung, um in die Heimat zurückzukehren. Die Töchter von Nazneen aber bestärken ihre inzwischen immer selbstbewusster gewordene Mutter darin, nicht mitzugehen nach Bangladesch, eine Entscheidung, bei der auch die Ereignisse von 9/11 eine gewichtige Rolle spielen. Um diesen Handlungskern herum breitet die Autorin auf vielen hundert Seiten Nazneens Weg aus der Unmündigkeit vor uns Lesern aus, berichtet minutiös vom kargen Leben der Immigranten in der Hauptstadt des Empire. Als Gegenpol dienen hierbei die Briefe der Schwester aus Dhaka, deren Leben alles andere als beneidenswert erscheint und die am Ende gar, vom Geliebten verlassen, als Prostituierte arbeitet. Und auch die Nachrichten von ihrem nichtsnutzigen Ehemann sind alles andere als ermutigend, Nazneen ist froh, ihm nicht gefolgt zu sein.
Die Widersprüche zwischen traditionell muslimischer und moderner westlicher Lebensweise sind hier wenig überzeugend dargestellt, die aus privilegierten britischen Verhältnissen stammende Autorin hat jedenfalls keinerlei autobiografische Erfahrungen in ihre Geschichte einbringen können, und das merkt man deutlich. Ihr Roman ähnelt einer schier endlosen, gefühlsduseligen Soap Opera mit hoffnungsvollem Ausgang, wobei sie wohlweislich nur beschreibt, die Geschehnisse also nicht bewertet. Das entscheidende Manko aber ist die quälende Langatmigkeit, in der die handlungsarme Story, völlig humorlos übrigens, erzählt wird. Eine Geduldsprobe für den Leser also, mindestens ebenso langweilig wie das Leben, das die Heldin mit ihrem Mann führen muss, bevor sie sich trennen. Schade, denn das sprachliche Können der Autorin, ihre Beobachtungsgabe, die Sensibilität, mit der sie alles Menschliche erfasst, ist ja durchaus vorhanden. Aber das allein reicht halt nicht für einen bereichernden, unterhaltsamen, lesenswerten Roman!
Fazit: miserabel
Meine Website: http://ortaia.de
Ist der Islam noch zu retten?
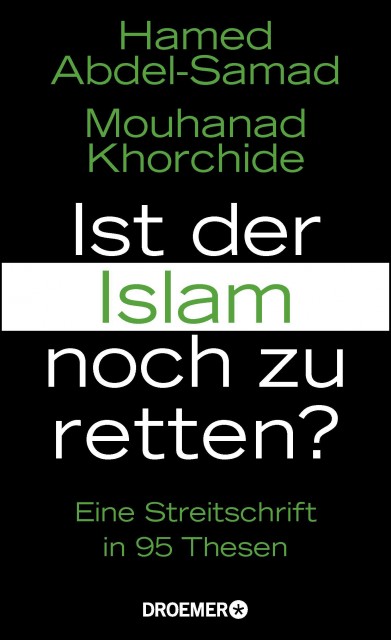 »Wir hatten in der Vergangenheit mehrfach Gelegenheit, in der Öffentlichkeit über den einen oder anderen Aspekt zum Thema Islam kontrovers zu diskutieren. Vielen Zuhörern oder Zusehern dürfte dabei aufgefallen sein, dass wir – obwohl wir oft unterschiedliche Positionen vertraten – in der Lage waren, sachlich zu streiten, ohne uns persönlich anzugreifen oder gegenseitig zu diffamieren. Dies ist heutzutage längst keine Selbstverständlichkeit mehr, schon gar nicht im innerislamischen Diskurs. Im Gegenteil ist es häufig so, dass sich derjenige, der eine andere Position als der Mainstream vertritt, mit dem Vorwurf der Häresie konfrontiert sieht.«
»Wir hatten in der Vergangenheit mehrfach Gelegenheit, in der Öffentlichkeit über den einen oder anderen Aspekt zum Thema Islam kontrovers zu diskutieren. Vielen Zuhörern oder Zusehern dürfte dabei aufgefallen sein, dass wir – obwohl wir oft unterschiedliche Positionen vertraten – in der Lage waren, sachlich zu streiten, ohne uns persönlich anzugreifen oder gegenseitig zu diffamieren. Dies ist heutzutage längst keine Selbstverständlichkeit mehr, schon gar nicht im innerislamischen Diskurs. Im Gegenteil ist es häufig so, dass sich derjenige, der eine andere Position als der Mainstream vertritt, mit dem Vorwurf der Häresie konfrontiert sieht.«
Hamed Abdel-Samad ist ein ägyptischer Aufklärer, der seit Jahren gegen Denkverbote anschreibt. Weswegen er unter Polizeischutz leben muss, gegen ihn wurde eine Mord-Fatwa verhängt.
Mouhanad Khorchide ist Professor für islamische Religionspädagogik, bildet Imane aus und setzt sich für eine offene Diskussion über Islam und Koran ein.
Sie vertreten unterschiedliche Positionen. In 95 Thesen diskutieren die beiden über die Rolle der Frau im Islam, Freiheit in der Religion, buchstabengetreue Koranauslegung, Dschihad und die Stellung des Islams zur Demokratie.
Naturgemäß sind sie nicht einer Meinung. Denn was »der Islam« ist, darüber gehen die Meinungen auseinander, einen einheitlichen Islam gibt es nicht. Wohl aber einen Mainstream, der sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat, der den Koran wörtlich auslegt, jede Diskussion sofort mit dem Vorwurf »Du bist kein Muslim« abwürgt und den Tod wegen Abfall von der Religion androht.
Mouhanad Khorchide setzt darauf, wieder die Mystik des Islams zu betonen und die Stellen des Korans, die die Liebe Gottes und dessen Barmherzigkeit beschwören. Hamed Abdel-Samad ist der Meinung, dass der Koran, solange er wörtlich genommen wird, zum Dschihad und zu Gewalt gegen Andersgläubige aufruft. Die Theologie der saudischen Wahabiten und anderer Dogmatiker argumentiert schließlich genauso wie der IS. Erst wenn der Koran von Muslimen nicht mehr als Wort Gottes verstanden wird, würde sich das ändern.
Doch es gibt im Koran unterschiedliche Texte. Die einen loben Juden und Christen. Die anderen verdammen sie. Heute berufen sich die Traditionalisten auf die radikalen Textstellen. Sie haben dafür eine eigene Interpretation entwickelt. Gott hat sich geirrt, als er Mohammed freundliche Suren diktierte. Und deshalb später das Gegenteil gesagt. Sozusagen eine V 2.0 des Korans abgeliefert, auf die sich nun alle Konservativen berufen. Zweifelsohne auch eine Interpretation und eine, die der Auffassung ist, dass Gott sich irren könnte.
Hamed Abdel-Samad hat in seinem Buch »der Koran« aufgezeigt, dass der Koran ein großer Supermarkt ist, für jeden ist etwas dabei. Wer Frieden halten will, findet dort genauso seine Stellen wie der, der zum heiligen Krieg auffordert. Wie in anderen Religionen auch legen die Fundamentalisten die Texte wortwörtlich aus – aber wählen die aus, die ihre Auslegung bestärken.
Dass der islamische Terror sich auf den Koran beruft und dort genügend Textstellen findet, die das stützen, ist sicher richtig. Aber warum gibt es diesen Terror erst seit den Achtzigern? Diese Frage wird leider nicht erörtert.
Ich bin Ende der Sechziger erwachsen geworden. Und kann mich an die Siebziger und die RAF erinnern. Dass der Vietcong im Vietnamkrieg die Supermacht Amerika besiegen konnte, hat viele befeuert. »Sieg im Volkskrieg« hieß es von da ab und in den westlichen Ländern bildeten sich marxistische Terrorgruppen. Sobald der Ostblock zusammen krachte, verschwanden auch all diese Volkskrieger.
In den Achtzigern konnten radikale Islamisten in Afghanistan die Supermacht Sowjetunion besiegen. Und seit dem gibt es die Parole: »Sieg im Dschihad«. Erfolg ist eine Droge, das darf man nicht vergessen.
Kann der Islam dieser Droge entkommen? Ist er zu retten?
Das Buch gibt naturgemäß auf die Frage nur einige mögliche Antworten, aber kein Rezept, das garantiert wirksam ist. Es ist eine ausführliche Diskussion theologischer Fragen, stellt den Mainstream vor, der mit Terror und Psychodruck seine Macht hat implementieren können und aufrechterhält. Ob sich dagegen andere Richtungen durchsetzen können? Seyran Ateş hat es zu spüren bekommen, wie schwer das ist, als sie und andere eine liberale Moschee gründeten.
Doch selbst der Katholizismus hat sich reformiert im Zweiten Vatikanischen Konzil. Davor musste jeder katholische Priester den Antimodernisten-Eid leisten und die Bibel wurde wörtlich ausgelegt. Man sollt nie die Hoffnung aufgeben.
Hamed Abdel-Samad und Mouhanad Khorchide haben jedenfalls gezeigt, dass man sachlich über Probleme reden kann, ohne den anderen zu verunglimpfen. Entstanden ist daraus eine solide Auseinandersetzung mit dem Islam.
Und ein Beispiel, wie wichtig solche Diskussionen sind. Meinungsfreiheit meint immer die Freiheit des Andersdenkenden, wusste schon Rosa Luxemburg. So manche Facebook Diskussion könnte von Hamed Abdel-Samad und Mouhanad Khorchide lernen. Und wir sollten dankbar sein, dass beide heute in Deutschland leben und arbeiten.
Hans Peter Roentgen
Leseprobe: http://www.bic-media.com/mobile/mobileWidget-jqm1.4.html?bgcolor=000000&layout=singlepage&layoutPopUp=doublepage&jumpTo=book&lang=de&isbn=9783426277348
Homepage der Autoren:
Hamed Abdel-Samad: Abdel Samad
Mouhanad Khorchide: https://Mouhanad Khorchide/
Schweigend steht der Wald
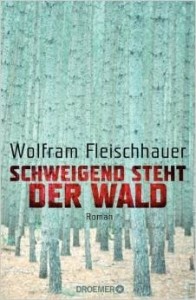 … und schüttelt den Kopf
… und schüttelt den Kopf
Schon der an das berühmte Gedicht von Mathias Claudius erinnernde Titel «Schweigend steht der Wald» wirkt unheimlich und düster, Autor Wolfram Fleischhauer nutzt geschickt den darin enthaltenen Mythos für seinen Roman. Der Deutsche und sein Wald, eine literarisch immer wieder anzutreffende, ganz spezielle Beziehung, deren Ursprünge in den uralten Märchen und Sagen zu finden sind. Hier nun dient der deutsche Wald sowohl als Bühne wie auch als Hintergrund einer Geschichte, deren Verlauf an einen richtigen Krimi erinnert, obwohl Autor und Verlag es vermutlich ganz bewusst unterlassen haben, den Roman als solchen zu deklarieren.
Und so birgt die Parzelle im Privatwald, in der die 28jährige Studentin der Forstwirtschaft im Rahmen eines Praktikums Bodenproben entnimmt, denn auch prompt ein düsteres Geheimnis. Ihr Vater ist in just diesem Waldstück vor zwanzig Jahren spurlos verschwunden, ein Trauma, welches sowohl Anja als auch ihre Mutter nicht haben überwinden können. Beide leiden an den Folgen, die Mutter hat einen Selbstmordversuch unternommen, die Tochter wird psychologisch betreut, ihr gelegentlich auftretendes Asthma ist psychosomatisch. Anja findet eine von der Umgebung abweichende Bodenprobe, und in den hinterlassenen Unterlagen ihres Vaters entdeckt sie, dass auch er kurz vor seinem Verschwinden genau an dieser Stelle ein ihm unerklärliches, völlig untypisches Brennnesselfeld gefunden hatte, ein Anzeiger für hohen Stickstoffgehalt im Boden, wie er zum Beispiel bei Verwesung auftritt. Der Leser glaubt nun an diesem frühen Punkt natürlich, die weiteren Entdeckungen schon zu kennen, die Anja bei ihren rastlosen Nachforschungen noch machen wird. Aber was sich da wirklich abgespielt hat an jener mysteriösen Stelle im Wald, das erfährt man tatsächlich erst sehr viel später, ganz am Ende des Romans.
In mehreren Handlungssträngen erzählt Fleischhauer eine aufregende Geschichte, die sich, von Rückblenden abgesehen, innerhalb weniger Wochen im Jahre 1999 ereignet. Er tut dies in angenehm klarer, nüchterner Sprache, seine Dialoge sind recht realitätsnah und somit glaubwürdig. Die gleich zu Beginn des Romans geschilderten Details von Anjas Arbeit im Oberpfälzer Wald dürften viele Leser irritieren, gerade darin aber sehe ich eine Stärke dieses Buches. Denn neben dem zweifellos für viele Leser attraktiven, weil ereignisreichen Plot wird hier nämlich auch mal eine andere Sicht auf den Wald geboten, auf die Belange der Forstwirtschaft und auf die Intentionen der Naturschützer, auf seine ökonomischen und ökologischen Funktionen also. Und auch der detailliert geschilderte Abschuss einer Wildsau weitet den Horizont des Normallesers sicherlich ungemein, alles Fachliche ist jedenfalls sorgfältig recherchiert. Also kein reiner Krimi, man könnte das alles sehr wohl auch als historischen Roman oder als Gesellschaftsroman ansehen.
So durchdacht und voller Überraschungen der Plot auch ist, ich empfand ihn letztendlich arg konstruiert, seine Figuren klischeehaft, seine Thematik wird dem realen, grauenhaften Geschehen nicht wirklich gerecht. Und der turbulente Showdown à la Hollywood ist leider derart aufgemotzt und unrealistisch, dass er damit die gesamte Geschichte nachträglich in Misskredit bringt. Besonders ärgerlich auch eine Stelle, wo die ansonsten so clevere Heldin über den Tod ihres Vaters sinniert: »Bären und Wölfe waren zwar selten, aber man musste stets mit ihrem Auftauchen rechnen». Ist es eigentlich Zufall, dass Anja mit Nachnamen Grimm heißt? War nicht auch Rotkäppchen dem Wolf zum Opfer gefallen? Schweigend steht der Wald – und schüttelt den Kopf!
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de
Die andere Heimat
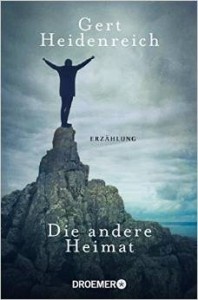 Besser lewe wie sterwe
Besser lewe wie sterwe
Im Nachwort dieses Buches, um mal ganz am Ende zu beginnen, erläutert der bekannte Filmregisseur Edgar Reitz seine Motive, warum er den Autor beauftragt hat, «unseren Recherchen, Gesprächen, Motivsuchen im Hunsrück und Spielen mit den Figuren der Schabbach-Geschichte in einer freien literarischen Erzählung, unabhängig von jeglicher Filmdramaturgie, Ausdruck zu verleihen». Herausgekommen ist dabei «Die andere Heimat», eine Erzählung aus dem Hunsrück, in welcher der vielseitig begabte Autor Gert Heidenreich, Ex-Mann der aus dem Fernsehen bekannten Literatur-Kritikerin Elke Heidenreich, das entbehrungsreiche ländliche Leben in der Mitte des 19ten Jahrhunderts beschreibt.
Schabbach heißt das kleine Dorf, in dem der Schmied Johann Simon seine Familie recht und schlecht durchbringen muss, wobei Schicksalsschläge und Naturkatastrophen seine Mühen immer wieder zunichte machen, seine Existenz bedrohen. Geschildert wird das unglaublich karge Leben fast aller Menschen in dieser Dorfgemeinschaft, einzig der Großbauer und Bürgermeister muss wohl nicht hungern. Waldfrevel ist deshalb an der Tagesordnung, man sammelt Pilze, Beeren, Eicheln, Bucheckern, natürlich auch Holz und anderes mehr, obwohl strenge Strafen drohen, wenn man erwischt wird. Die Kindersterblichkeit ist hoch, die medizinische Versorgung rudimentär, mit vierzig Jahren ist man alt. Jakob, jüngster Sohn des Schmieds, träumt vom besseren Leben in Brasilien, verschlingt geradezu alle Bücher über Südamerika und ist fest entschlossen, bei sich bietender Gelegenheit auszuwandern, in «die andere Heimat» also, um dort sein Glück zu machen. Es kommt anders, mehr sei hier aber nicht verraten.
Natürlich gibt es auch allerlei Liebesleid, Verwirrungen zwischen den Geschlechtern, es finden nicht immer die zusammen, die eigentlich zusammen gehören, und oft ist die Vernunft und wirtschaftliches Kalkül der Ehestifter, den Gefühlen zum Trotz. Der Autor entwickelt seine Geschichte in etlichen Rückblenden, seine diversen Figuren sind anschaulich und glaubhaft beschrieben, genau so, wie sie das karge Landleben geformt hat. Für fast alle Dialoge benutzt er die heimische Mundart, – was mich aber nicht weiter gestört hat, zu meinem Erstaunen, muss ich hinzufügen. Denn Fontanes Roman «Unterm Birnbaum» zum Beispiel, mit vielen Passagen in Plattdeutsch, ist für mich schlichtweg unlesbar, obwohl ich bekennender Fontane-Fan bin, – ich bin deshalb übrigens auf die Hörbuchversion mit Westphal ausgewichen, aber das nur nebenbei. Hier bei Gert Heidenreich nun verstärken seine, für mich jedenfalls, deutlich leichter lesbaren Mundart-Dialoge das Lokalkolorit, die zu vermittelnde Atmosphäre wird wunderbar homogen dadurch und wirkt überaus authentisch. Sprachlich ist die detailreich erzählte Geschichte geradlinig und unprätentiös angelegt, insgesamt jedoch ziemlich holzschnittartig wirkend, fast naiv. Leicht lesbar mithin, wobei allenfalls die beachtliche Figurenfülle, zusätzlich erschwert noch durch einige Namensvarianten, zu erhöhter Aufmerksamkeit (oder zum Spickzettel) zwingt.
Zweifellos ist dieses Buch vor allem auch ein Zeitdokument, gut recherchiert offenbar und ebenso komprimiert wie stimmig über ein heute weitgehend unbekanntes Milieu informierend, in jenen Zeiten angesiedelte Literatur bewegt sich ja sonst zumeist in Adelskreisen oder in der Bourgeoisie. Der Leser begegnet immer wieder einer erstaunlichen Gottergebenheit, ein Fatalismus übrigens, der fast allen Protagonisten zueigen ist und uns Heutige nun doch einigermaßen überrascht. Aber man trifft eben auch auf Figuren wie die vom Schicksal gebeutelte Lotte, die weinselig ihre schlichte Devise verkündet: «Besser lewe wie sterwe». Dem ist nichts hinzuzufügen.
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
Still – Chronik eines Mörders
Ein leises, märchenhaftes Buch über ein zu lautes Leben
 Gleich vorweg: dieses Buch einem bestimmten Genre zuzuordnen fällt mir schwer. Ein bisschen Thriller, ein bisschen Krimi, ganz viel Familiengeschichte aber hauptsächlich ein Drama, so sehe ich diese anrührende Geschichte.
Gleich vorweg: dieses Buch einem bestimmten Genre zuzuordnen fällt mir schwer. Ein bisschen Thriller, ein bisschen Krimi, ganz viel Familiengeschichte aber hauptsächlich ein Drama, so sehe ich diese anrührende Geschichte.
Wer einen Roman ohne Tod und Unheil erwartet ist hier falsch, wer einen blutrünstigen Thriller möchte, ebenfalls.
Blut fließt trotzdem, reichlich sogar, aber der Reihe nach.
Der Protagonist Karl wird in einem kleinen, verschlafenen Nest geboren und hält von Anfang an seine Eltern in Atem. Nicht, weil sich hier schon seine Bösartigkeit zeigen würde, sondern weil er schreit. Laut. Immer. Ohne Pause, so dass ein ganzes Dorf in Mitleidenschaft gezogen wird.
Als alle Beteiligten schon fast mit ihren Nerven am Ende sind, findet sein Vater den Grund für das Gebrüll heraus: Der kleine Karl hat ein hypersensibles Gehör, besser als jeder andere Mensch hört er selbst die leisesten Töne, entferntesten Gespräche und Lebensgeräusche. Eine für Andere normale Lautstärke bereitet ihm körperliche und seelische Schmerzen, weswegen ihm seine Eltern schließlich ein isoliertes Zimmer im Keller einrichten. Hier lebt er vor sich hin, findet schnell Freude an Büchern und zeigt eine hohe Intelligenz. Einen Zugang zu seiner Mutter findet er jedoch nicht, ebenso wenig, wie sie zu ihm. Sie ist mit einer derartig hohen, quakigen Stimme gesegnet, dass er sie schon im Mutterleib nicht ertragen konnte.
Die Jahre gehen ins Land, Karl im Keller, das restliche Leben oberhalb. Was niemand bedenkt: Karl kann selbst geflüsterte Gespräche hören, immer mehr erkennt er, wie anders er ist, wie er abgelehnt wird. Er beginnt zu fühlen, was Unrecht ist, als seine Mutter ein Verhältnis mit dem Dorfarzt beginnt. Nach einem tragischen Ereignis erkennt er schließlich, dass das einzig Schöne, Stille der Tod ist. Nur hierin erkennt er Liebe, versteht nicht, warum die Menschen am Leben festhalten, wenn der Tod doch so viel besser ist. Er beschließt, den Menschen zu helfen, in der Annahme, wirklich Gutes zu tun und ab hier beginnt die blutige Spur, die auf dem Klappentext des Buches vermerkt ist.
Karls Leben nimmt viele Wendungen, nur wenig Schönes passiert ihm, mit einer Ausnahme: Er begegnet einem ganz besonderen Menschen, der ihn bis zu seinem Lebensende nicht mehr loslassen wird. Das Ende ist konsequent und emotional, nicht wirklich unerwartet, aber richtig.
Wie so oft, wird einen kurze Inhaltsangabe dem eigentlichen Text nicht gerecht, das Buch ist so unglaublich großartig geschrieben, so märchenhaft und zeitlos, dass mir nur ein passender Vergleich eingefallen ist: „Das Parfum“ von Patrick Süßkind. Dieser Roman gehört für mich zu den ganz Großen und Thomas Raabs „Still“ kann hier meiner Meinung nach problemlos mithalten.
Im Anfangssatz hatte ich geschrieben, dass dies ein leises Buch sei. Das meine ich absolut positiv. Der Autor hat es verstanden, das Leben Karls aufzuzeigen und mich daran teilhaben zu lassen, ohne „laute“ Worte zu verlieren. Es sterben so viele Menschen, und trotzdem wirkt der Tod immer leise und friedlich, wie von Karl beabsichtigt. Immer wieder überzog mich ein leises Gruseln, insbesondere im Mittelteil, weil Karl wahrscheinlich als größter Massenmörder in die Geschichte eingehen könnte, wäre er nicht fiktiv. Trotzdem artet das ganze niemals in ein in ein Splatter-Gemetzel-Buch aus.
Alle Figuren sind sehr anschaulich beschrieben, keine klischeehaft oder langweilig. Die Hauptfiguren sind etwas Besonderes. Keine ist eindeutig gut oder böse, die ganze Geschichte an keiner Stelle einfach schwarz-weiß. Offensichtlich ist hier natürlich Karl, der nach den Maßstäben unserer Gesellschaft Böses tut, aber in der Annahme, den Menschen zu helfen.
Auch einige der anderen Figuren sind durchaus ambivalent zu sehen und diese Geschichte wird mir noch sehr lange im Kopf bleiben.
Der Sprachstil ist unheimlich bildreich, metaphorisch und einfühlsam, nicht nur inhaltlich ist dieses Buch lesenwert, sondern auch, weil Thomas Raab sich hier als wunderbarer Sprachkünstler präsentiert.
Für mich ist dies eines der bemerkenswertesten Bücher dieses Jahres, ich werde es sicher noch ein zweites Mal lesen.
Das Gedankenexperiment
Jonas Winner schreibt intelligente Romane, die den Leser fordern. Im »Gedankenexperiment« befasst er sich in erster Linie mit einer philosophisch-lingustischen Grundfrage der Sprachtheorie. Es geht ihm dabei um die Diskussion, woher die menschliche Sprache eigentlich kommt. Ist es denkbar, dass ein mit unserem Körper verknüpftes »Sprachwesen« in uns haust, das Macht über unseren Geist hat und dem wir – unter geeigneten Umständen – vielleicht sogar begegnen können?
Stammt also möglicherweise das, was wir sagen, gar nicht von uns, sondern von dieser geheimnisvollen Wesenheit, die unsere gesamte zwischenmenschliche Kommunikation steuert? Und was ist, wenn wir dieses Sprachwesen als dreidimensionales Etwas in uns hocken sehen, es aber nicht (be)greifen können – treibt uns das möglicherweise in den Wahnsinn? Ist der Verlust des Verstandes, beziehungsweise das, was wir darunter verstehen, der Preis, der gezahlt werden muss, um das Wesen zu erkennen?
Der Forscher Leonard Habich, der in einem verwinkelten Schloss mit unterirdischen Gängen und Gewölben residiert, ist dieser Idee verfallen. Seinen »Verfall« muss Karl Borchert, ein aufstrebender Philosoph, der eine Stelle als dessen Privatsekretär antritt, bald feststellen. Habich will ein bahnbrechendes Werk zum Abschluss bringen, an dem er seit Jahrzehnten arbeitet, Borchert soll ihm dabei helfen. Doch es gibt mehr als gemeinsame philosophische Interessen zwischen den beiden. Denn wie kommt es, dass der alte Forscher seinen jungen Assistenten Borchert und dessen wissenschaftliche Arbeit so genau kennt? Wieso war er ausgerechnet mit seinem Vater, einem Chirurgen, befreundet, der seinen Sohn in jungen Jahren nach einem tragischen Fahrradunfall an einer schweren Kopfverletzung operierte? Was steckt wirklich hinter den Forschungen, die auf dem Schlossgelände betrieben werden? Existiert dort eine Höllenmaschine, die jeden auf eine Irrsinnsreise schickt? Werden eventuell sogar Menschenexperimente gemacht?
Jonas Winner versteht es, eine vielschichtige wissenschaftliche Theorie in eine durchaus spannende Rahmenhandlung einzubinden. Er versäumt dabei nicht, auf versunkenes Geheimwissen anzuspielen und paradigmenstiftende Verschwörungstheorien einzuflechten. Nicht zufällig spricht Habich Henochisch, eine alte magische Sprache, die auch »Sprache der Engel« genannt wird.
Philosophen haben wohl immer schon davon geträumt, den eigenen Geist wie ein Besucher betreten und sich darin umsehen zu können, also in sich selbst spazieren zu gehen. Platon, Descartes und Wittgenstein beschäftigten sich mit der Thematik, die zuletzt in wilden Hippiezeiten wieder aufkam, in denen unter Drogeneinfluss (Winner lässt diesen Aspekt allerdings aus) versucht wurde, einen vom Bewusstsein losgelösten äußeren Einstieg in die Innenwelt zu erlangen. Gern wird diese Diskussion mit der Grundsatzfrage verknüpft, wie die Sprache überhaupt entstand und in unsere Köpfe gelangte. Philosophisch delikat dabei ist der Aspekt, dass das Medium, in dem nachgedacht wird identisch ist mit dem Gegenstand, über den nachgedacht wird.
In diesem Zusammenhang taucht im Roman natürlich auch der berühmte US-Linguistiker Noam Chomsky auf, der mit der »Chomsky-Hierarchie« unter anderem versuchte, eine Metasprache zu entwickeln. Der Forscher machte geltend, dass die Daten, die wir als Kind empfangen, zu dünn seien, als dass allein dadurch etwas derartiges Komplexes wie die Sprache erlernt werden könne. Nach seiner Auffassung muss es eine Art angeborene Sprachkompetenzorgan im Hirn geben, dessen Parameter durch die Eindrücke des Kindes eingestellt werden, vergleichbar etwa mit einem Computer, bei dessen Erstinstallation die Sprache eingestellt wird. Auf diesem Gedanken wiederum fußt Habichs Theorie vom Sprachwesen, das eine Symbiose mit dem menschlichen Körper eingeht.
Jonas Winners Roman spricht Leser an, die sich für philosophische Paradigmen und Theorien der Sprachentwicklung interessieren. Der Autor macht es als promovierter Philosoph dem Leser dabei nicht ganz einfach, wenn er die Weiterentwicklung von der Seins- über die Bewusstseins zur Sprachphilosophie als »Dreischritt« begreift, dem ein vierter Schritt folgen müsse: »Den Grundgedanken, dass wir gefangen sein könnten, dass wir getäuscht werden könnten, dass jemand absichtlich ein Schild aufgestellt haben könnte, um uns in die Irre zu führen. Den Grundgedanken, das wir erst dann aus einer inszenierten Verwirrung herauskommen, wenn wir begreifen, dass wir Opfer einer Verschwörung sein könnten. Opfer derjenigen, die uns als Gefangene in einer Höhle halten.« (S. 129)
Vielleicht lässt sich »Das Gedankeninstrument« als Wissenschaftskrimi beschreiben. Denn gut drei Viertel des Werkes könnten auch als populäres Sachbuch zum Thema Sprache durchgehen. Dass er trotzdem die Kurve bekommt und die ganze Geschichte spannend verpackt, ist eine absolute Stärke des Autors.
Das Jesus Video
Ein Team von Archäologen entdeckt bei gezielten Grabungen in Israel ein 2000 Jahre altes Skelett, das offensichtlich von einem Zeitreisenden stammt. Bei ihm findet sich die Gebrauchsanleitung einer Videokamera, die zum Zeitpunkt der Entdeckung noch nicht einmal gebaut worden ist. Bald verdichten sich die Vermutungen, dass der geheimnisvolle Tote Videoaufnahmen von Jesus Christus gemacht haben muss. Der Tote im Grab ist demnach ein Mann der Zukunft, der in die Vergangenheit reiste, um sich dort ein Bild von der Wahrheit zu machen: Lebte Jesus wirklich? Doch wo hat er die Aufnahmen deponiert, und ist die Kirche wirklich daran interessiert, die Wahrheit über den Gottessohn zu erfahren?
Ein stürmisches Tauziehen zwischen Archäologen, Geschäftemachern, der vatikanischen Inquisition und einem engagierten Team junger Forscher beginnt, und die abenteuerliche Schussfahrt durch Israel nimmt bald das Tempo einer Indiana-Jones-Episode an.