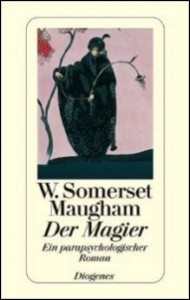 Hokuspokus
Hokuspokus
Mit dem Titel «Der Magier» des 1908 erschienenen Romans von William Somerset Maugham wird auf das Sujet schon ziemlich deutlich hingewiesen, spätestens der Untertitel «Ein parapsychologischer Roman» sollte dem potentiellen Leser aber klarmachen, hier geht es um Irrationales, Übersinnliches, was bekanntlich nicht jedermanns Sache ist. Mit Logik nämlich kommt man da nicht weit. Ich war also vorgewarnt, wollte einen derartigen Roman aber unbedingt auch mal lesen. Der im Zwanzigsten Jahrhundert zu den erfolgreichsten englischsprachigen Autoren zählende Maugham hatte einen ausgeprägten Instinkt für erzählenswerte Geschichten verschiedenster Thematik, und er hatte die Begabung, sie in publikumswirksamer Weise literarisch umzusetzen, wovon der vorliegende Roman zeugt, bei dem für den Magier der geistige Führer des okkulten Satanismus Aleister Crowley Vorbild war.
Die junge Engländerin Margaret, deren außergewöhnliche Schönheit der Autor immer wieder geradezu hymnisch beschreibt, verbringt vor der Hochzeit zwei Jahre in Paris bei ihrer Freundin Susie, um zeichnen zu lernen. Sie ist verlobt mit dem erfolgreichen Chirurgen Arthur Burton, der auch ihr Vormund ist. Als er sie dort besucht, lernen sie Oliver Haddo kennen, ein schriller Außenseiter, dem man magische Fähigkeiten nachsagt. Äußerlich abstoßend, unförmig dick, gekleidet wie ein Paradiesvogel, steinreich, weitgereist, dabei ungehobelt wirkend in seiner prahlerischen Art, die immer auch Bosheit durchschimmern lässt, fasziniert er anderseits seine Gesprächspartner auf magische Weise mit seinen abenteuerlichen Erzählungen, bei denen immer unklar bleibt, ob sie wahr sind oder frech erfunden. Besonders bei okkulten Themen, mit denen sich auch Arthurs älterer Freund Dr. Porhoët beschäftigt, erweisen sich seine Kenntnisse der historischen Quellen als schier unerschöpflich, er zieht seine Zuhörer in Bann mit den vielen Geschichten, die er darüber zu erzählen weiß. Margaret findet ihn widerlich und abstoßend, Artur als Vernunftmensch belächelt ihn nur. Gleichwohl, – nur Maugham gelingen solche aberwitzigen Wenden, verlässt Margaret ihn wenig später ohne ein Wort und heiratet Knall auf Fall, für alle unfassbar, nicht nur für die Leser, den abstoßend hässlichen und fetten Haddo, er hatte wohl durch geheimen Zauberkräfte Macht über sie bekommen. «Ein Teufel muss in ihren Körper gefahren sein» mutmaßt der völlig aus der Bahn geworfene Arthur.
Mit dieser überraschenden Wende zu Beginn des zehnten von insgesamt sechzehn Kapiteln nimmt der parapsychologische Roman ein wenig Schwung auf, die erste Hälfte setzt bei spiritistisch unterbelichteten Lesern wie mir unendliche Geduld voraus mit ihren immer wieder neuen, obskuren Geschichten. Offensichtlich hat der Autor gründlich recherchiert für sein Buch, als Laie wird man aber durch eine wahre Flut von Hokuspokus regelrecht zugeschüttet, ohne irgendeinen Gewinn davon zu haben. Nun gut, das ist sicher Geschmackssache! Im letzten Teil, in dem die arme Margaret dann ihr Leben lassen muss und Arthur alles dransetzt, Haddo das Handwerk zu legen, kommt Spannung auf, man erlebt sogar einen telekinetischen Mord. Wo sonst gibt es so was schon mal zu lesen – außer im Märchen? Der Showdown dann erinnert mit brennendem Herrenhaus im Hintergrund an Hollywood.
Auktorial erzählt in einer arabeskenreichen Sprache, die gleichwohl zielgerichtet ist, also linear und einsträngig, ohne Rückblenden, wird die Handlung weitgehend durch stimmige Dialoge erschlossen. Maughams Figuren sind einprägsam geschildert in einem für ihn typischen, zwischen England und Frankreich oszillierenden Milieu, zu dem der Five-o’clock-tea nun mal zwingend dazugehört. In der zweiten Hälfte des Plots wird man wie gesagt angenehmer unterhalten, bis dahin muss man sich eben irgendwie durchkämpfen, wenn man zu den rational veranlagten Lesern gehört, bei denen jede Fiktion auch ihre Grenzen hat. Aber genau zu denen gehöre ich halt!
Fazit: miserabel
Meine Website: http://ortaia.de
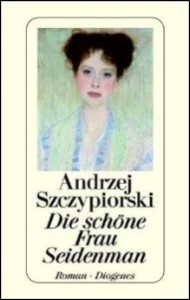 Noch ist Polen nicht verloren
Noch ist Polen nicht verloren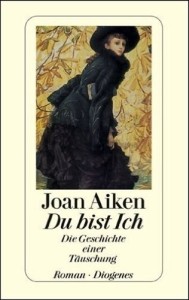 Im Prinzip Kitsch
Im Prinzip Kitsch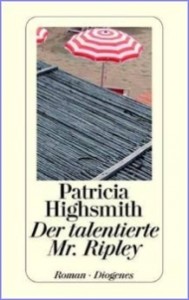 Wenn das Böse obsiegt
Wenn das Böse obsiegt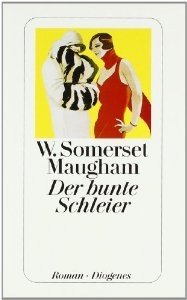 In der ersten Reihe zweitklassiger Autoren?
In der ersten Reihe zweitklassiger Autoren?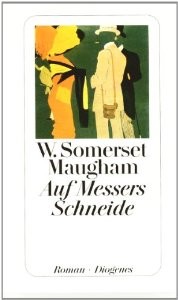
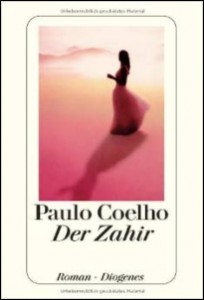 Die unerträgliche Seichtigkeit des Scheins
Die unerträgliche Seichtigkeit des Scheins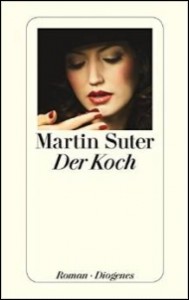 Geistige Schonkost, kein Feinschmeckermenu
Geistige Schonkost, kein Feinschmeckermenu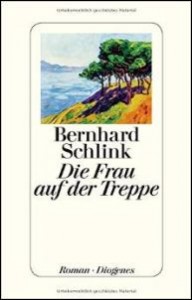 Reine Inhaltsliteratur
Reine Inhaltsliteratur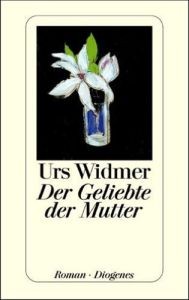 Requiem für eine besessene Frau
Requiem für eine besessene Frau Die Parabel von den drei Krüppeln
Die Parabel von den drei Krüppeln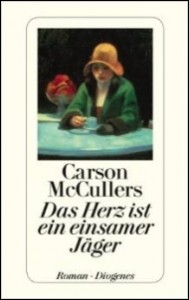 Mit literarischem Widerhall
Mit literarischem Widerhall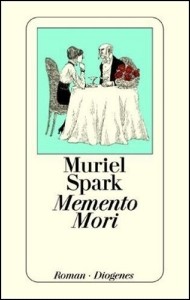 Ein Denkanstoß
Ein Denkanstoß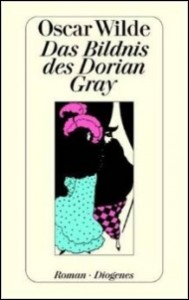 Von Bonmot zu Bonmot
Von Bonmot zu Bonmot
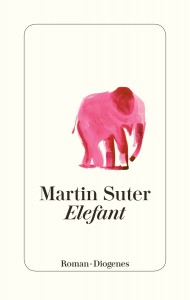 Martin Suter erzählt eine bezaubernde Geschichte um einen kleinen rosa Elefanten, der im Dunkeln phosphoreszierend schimmert. Dieses klitzekleine Wesen, das mit Holzscheiten statt Baumstämmen jongliert und das Herz jedes Kindes hochschlagen lassen würde, ist keine Schöpfung der Spielwarenindustrie. Es handelt sich um das Produkt geldgieriger Genmanipulateure, die an der Produktion von »glowing animals« (glühenden Tieren) arbeiten und dabei jeden Tier- und Artenschutz außer Acht lassen.
Martin Suter erzählt eine bezaubernde Geschichte um einen kleinen rosa Elefanten, der im Dunkeln phosphoreszierend schimmert. Dieses klitzekleine Wesen, das mit Holzscheiten statt Baumstämmen jongliert und das Herz jedes Kindes hochschlagen lassen würde, ist keine Schöpfung der Spielwarenindustrie. Es handelt sich um das Produkt geldgieriger Genmanipulateure, die an der Produktion von »glowing animals« (glühenden Tieren) arbeiten und dabei jeden Tier- und Artenschutz außer Acht lassen.