Was für eine Frau! Sprühend vor Energie, überquellend von Geschichten, strahlend, charmant und auch im Alter auf besondere Weise schön. Zu ihrem 90. Geburtstag hat Ilse Eliza Zellermayer sich selbst und die Leserschaft mit einem Buch beschenkt, das aus dem alten und „mitteljungen“ Berlin sowie aus der Welt der Musik erzählt.
1920 geboren, wuchs sie im vornehmen Hotel am Steinplatz aus, das ihr Vater, der Bankier Max Zellermayer, aufgebaut und zugleich als Wohnstatt für seine nun fünfköpfige Familie auserkoren hatte. Von klein auf hatte die Autorin Umgang mit verschiedensten Gästen aus vielen Ländern, mit emigrierten russischen (wie zum Beispiel den Nabokows) und polnischen Adligen, mit Künstlern und Gelehrten, die hier immer wieder und oft langfristig Aufnahme fanden. Unterhaltsam und aufschlußreich schildert sie den Hotelalltag, die großen und kleinen Marotten der Gäste und wie liebevoll die Zellermayers und ihre Mannschaft sich um ihr Wohlergehen kümmerten. Der Geiger Yehudi Menuhin gehörte zu den treuesten Gästen: Bereits in den Goldenen Zwanzigern war das Wunderkind am Steinplatz zu Gast und kam auch nach dem Krieg immer wieder gern zurück.
Das Hotel war der Fixpunkt der Familie Zellermayer und blieb dies trotz schwerer Schicksalsschläge wie der Tod des Vaters 1933 und die Jahre von Nationalsozialismus und Krieg.
Anekdoten berichten vom schwierigen Neuanfang, von Ziege Beate, die für die Gäste Milch und Sahne lieferte, von Tomaten auf dem Dach und Champignonzucht im Keller. Bruder Heinz setzte sich erfolgreich für die Aufhebung der Sperrstunde ein und wurde später Herr eines ganzen Gastronomie- und Hotelimperiums zwischen Berlin und Paris, während Bruder Achim sich unter anderem beim Aufbau der Künstlerkneipe Volle Pulle verwirklichen konnte, die dem Hotel am Steinplatz angeschlossen war und Stammgäste wie Gottfried Benn, Heinrich Böll oder Günter Grass anzog.
Ilse Eliza Zellermayer wirkte über Jahrzehnte im Familienbetrieb mit, verfolgte aber stets auch eigene Wege. Als ihr die Karriere als Opernsängerin verwehrt blieb, setzte sie sich mit Leidenschaft und Charisma für andere Sänger ein und eröffnete als erste Frau in Deutschland eine Opernagentur. Sie lebte und litt mit ihren Künstlern und managte deren Auftritte. Durch ihre zahlreichen Kontakte und ihre Weltläufigkeit, durch ihr Wissen um die Musik und ihre Einfühlsamkeit war ihre Arbeit außerordentlich erfolgreich. Mit ihrer Unterstützung eroberten Luciano Pavarotti, Mirella Freni, Giuseppe Di Stefano oder Anna Moffo die großen Opernbühnen der Welt.
Über allem aber steht bei Ilse Eliza Zellermayer die Liebe, im beruflichen wie im privaten Leben. Zweimal war sie verheiratet, doch die wahre Liebe fand sie in dem Pianisten, Organisten und Komponisten Jean Guillou, mit dem sie Anfang der sechziger Jahre liiert war und der sie wie durch ein Wunder kurz vor ihrem 88. Geburtstag wiederfand. Mit ihm verbindet sie eine wunderbare Vertrautheit, die sie glücklich macht.
Der Aufbau Verlag präsentiert mit diesem Buch das charmante Zeitzeugnis einer eigenwilligen Frau, das durch diverse diskret-indiskrete Klatschgeschichten seinen zusätzlichen Reiz bekommt.
Archiv
Prinzessinnensuite
1975 Im Jahr der Weiber
Sommer 1975. Vier Freunde: Appaz, Kerschkamp, Lepcke und Ratte sind sozusagen im Kollektiv durch das Abitur gefallen. Ungeachtet dieser Niederlage, an der ihrer Meinung nach ohnehin nur die Pauker und das System Schuld sind, beschließen sie, ihre lange geplante Frankreichreise anzutreten.
Zu diesem Zweck wird ein Kleinbus besorgt, ein rotweißer VW-Bus Baujahr 1964. Ausgerüstet mit Unmengen von Lebensmitteln und Getränken jeder Art beginnen die Vier, mit einem weiteren Freund, dem Ami, ihre Reise, die Heavy Tour 75. Kurz hinter Saarbrücken an der Grenze nach Frankreich gibt es den ersten Ärger, als Zoll und Polizei große Beute wittern, da fünf wild aussehende langhaarige Jungs die Grenze überqueren wollen. Nach einem kurzen Aufenthalt liegt Frankreich vor ihnen und es beginnt eine mehrwöchige Reise durch das Land. Sie lernen das Land kennen und Leute, die genau so wie sie auf der Reise sind, sie zelten an den Stränden des Meeres und sie sind Gäste bei Aussteigern und in Wohngemeinschaften.
»1975 Im Jahr der Weiber« ist eine wundervolle Geschichte voller Lebensfreude und gleichzeitig eine sympathische Erinnerung an eine unbeschwerte Jugend. An eine Zeit, in der die Feindbilder klar waren, an eine Zeit, die voll war mit Love, Peace und Rock n\’Roll. Beim Lesen spürt man den Sommerwind auf der Haut, schmeckt den Wein und hört das Knistern der Joints.
Dieses Buch ist eine große Freude.
Ich
Rechtzeitig zu ihrem 50. Geburtstag am 14. Juni 2006 legt die italienische Rocklady Gianna Nannini ihre Autobiographie vor. Die Musikerin präsentiert sich darin als eine von vielen Seiten getriebene, in einem bunten Mix von zufälligen und geplanten Begegnungen geformte Persönlichkeit auf dem Weg zum Olymp der europäischen Rockmusik.
Früh rebellierte der Spross einer reichen Konditorenfamilie aus dem toskanischen Siena und versuchte, aus vorgezeichneten Bahnen auszubrechen. Sie ging nach Mailand, tingelte durch Kneipen und lernte dabei immer wieder Menschen kennen, die ihren Weg bestimmten: Musiker, Texter, Journalisten, Produzenten, Schallplattenbosse. Wer die im Stakkato geschriebene und sich gern in Andeutungen und Sprachbilder fliehende Lebensgeschichte liest, gewinnt den Eindruck, dass Gianna Nannini in einem Wirbelsturm aus Drogen, Depressionen und Desaster zum Erfolg flog und davon selbst äußerst wenig bewusst wahr nahm. Eher zufällig promovierte sie nebenher und schuf musikalische Welterfolge. Erst spät scheint sie sich zu besinnen und auf die Suche nach sich selbst zu gehen.
»Ich« orientiert sich im Aufbau an den Songs der Künstlerin, die in den letzten dreißig Jahren entstanden. Das Buch empfiehlt sich damit vor allem denjenigen Fans, die mit den rebellischen, oft bitteren und impulsiven Songs der Schöpferin von »Latin Lover« und »Notti magiche« vertraut sind.
Dorfpunks
Seine Kindheit und Jugend als »OH-Sub«, ein »Ost-Holstein-Punk«, beschreibt Rocko Schamoni in seinem autobiographischen Roman »Dorfpunks«. In lakonisch unbehauenem Stil und uninteressiert an filigraner Sprache erzählt der 1966 geborene Autor von der Trostlosigkeit und tödlichen Langeweile des 5000-Seelen-Ortes Schmalenstedt an der Ostsee, die seinen Hang zu Suff und Gewalt förderte. Dort erhält er die ideale Grundausbildung für seine Punkwerdung, die sich im Bemühen um Anderssein und ein schmutziges und zerfetztes Äußeres zeigt. Zusammengehalten aus einem Kitt von Alkohol, Drogen, Nikotin, Video und Gewalt gründet Schamoni »Die Amigos«, eine Zwei-Mann-Truppe, die sich mit Schlagern und Saufliedern interessant macht und meist den Auftakt für eine vollständige Zerstörung der Saaleinrichtung liefert. Daneben bestimmen Schulstress, Liebeskummer, der Traum von der großen Stadt und eine Töpferlehre das Leben des jungen Mannes, der sich heute als »Musiker, Lebemann und Autor« bezeichnet, verschiedene Alben veröffentlichte und Musiksendungen moderierte.
Die Lektüre von „Dorfpunks“ hinterlässt einen seltsamen Geschmack. Im Text wächst keine Persönlichkeit, die ein künstlerisches Ziel vor Augen hat und intensiv daran arbeitet. Es geht ausschließlich darum, aus Enge und Langeweile auszubrechen, um nach Hamburg oder Berlin zu kommen, wo ein selbst bestimmtes Leben lockt. Gleichwohl ist es ein einfühlsamer Rückblick mit Sinn für Komik und Tragik. »Entschuldigung, es ging nicht anders«, schreibt der Autor zu seinem ungeschminkten Bericht und erklärt damit seine Punk-Haltung mit einer gewissen Zwangsläufigkeit.
Der schwarze Herr Baßethub
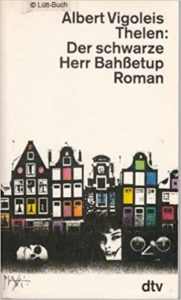 In seinem zweiten Memoirenroman, der nach Mallorca in Amsterdam spielt, erweist sich Don Vigo erneut als Meister des mäandernden Monologs.
In seinem zweiten Memoirenroman, der nach Mallorca in Amsterdam spielt, erweist sich Don Vigo erneut als Meister des mäandernden Monologs.
Ins Detail verliebt beschreibt er seine Rolle als Begleiter eines rabenschwarzen brasilianischen Gelehrten durch die holländische Metropole, von dem erst in den letzten Zeilen enthüllt wird, ob es sich um einen Hochstapler, ein Genie oder eine tragische Gestalt handelt.
Wie bereits in seiner »Insel des zweiten Gesichts« breitet Thelen auch in diesem Band sein lexikalisches Wissen über historische Zusammenhänge ebenso ausführlich aus wie augenzwinkernde Beobachtungen des Alltagslebens in den Niederlanden und das Wesen ihrer Bewohner.
Thelen ist ein ausufernder Erzähler, das macht sein Werk zu anspruchsvoller Lektüre. Doch das Vergnügen, diesen Eulenspiegel begleiten zu dürfen, überwiegt.
Thelen ist eine echte Entdeckung unter den deutschsprachigen Erzählern.
Lenin kam nur bis Lüdenscheid
Hier beschreibt ein 1964 geborener Autor seine Kindheit und Jugend, die wesentlich bestimmt war durch die provinzielle Enge Solingens, in dem er aufwuchs und die politische Haltung seiner Eltern. Die waren im Geist der damaligen Zeit links eingestellt und bewegten sich zwischen Naturfreunden, Spontis und DKP-Kommunisten, die der Hass auf die den Vietnamkrieg führende Supermacht USA einte. Prechts Eltern engagierten sich weitgehender als andere und adoptierten zwei vietnamesische Kriegskinder, die wie Geschwister des Autors aufwuchsen. Sie verbannten von Coca-Cola bis Ketchup alles, was einen amerikanischen Schatten trug und wehrten sich auch gegen die »Verdummungsmaschine« Fernseher.
Precht versucht in seinem Buch, die Haltung seiner Eltern zu verstehen und den Kontext zu erklären, in dem sie dachten und handelten. Dabei ist ihm hoch anzurechnen, dass er weder ins große Jammern über ein versunkenes Idyll ausbricht noch die antiautoritären Achtundsechziger als mephistophelische Ausgeburt verdammt, wie es derzeit modern zu sein scheint. Er müht sich aufrichtig, Antworten auf Fragen zu finden, die mit seiner eigenen Entwicklung zu tun haben. Dieses Bemühen scheitert allerdings daran, dass er aus der Perspektive desjenigen berichtet, der sich die meisten Zusammenhänge erst im Nachhinein aus Büchern erarbeitet hat. Besser wäre sicherlich gewesen, er hätte sich auf sein Erinnern beschränkt und den Oberlehrer weggelassen. Und an dem ständigen Hin und Her zwischen den Polen krankt der gesamte Bericht, von dem nie ganz klar wird, ob es sich um eine Autobiographie, einen Hintergrundbericht oder ein Feuilleton handelt. Gänzlich hilflos wirkt der Autor, wenn er in der Jetztzeit landet, und sich wie ein Schneekönig freut, wenn ihn ein Typ wie Guido Westerwelle in burschikoser Freundschaft »Junge« nennt.
Die Insel des zweiten Gesichts
 Schelmenroman des Ex-Sekretärs von Harry Graf Kessler über seinen fünfjährigen Mallorcaaufenthalt 1931-1936.
Schelmenroman des Ex-Sekretärs von Harry Graf Kessler über seinen fünfjährigen Mallorcaaufenthalt 1931-1936.
Anspruchsvoll geschrieben, unterhaltsam erzählt, farbenfroh geschmückt bietet die voluminöse Autobiographie auch demjenigen Lesevergnügen, der keine Auszeit auf der Insel der (vermeintlichen) Ruhe genossen hat.
Der Text ist sprachlich anspruchsvoll, und der Schinken verlangt vom Leser einige Konzentration. Aufgrund der sprachkünstlerischen Eigenleistung des Autors fällt es bisweilen schwer, dem eigenwilligen Stil des Werkes treu zu bleiben.
Sind aber erst einmal die ersten hundert Seiten überstanden und findet man sich mit dem permanenten Eigenlob Thelens über Redekunst und Einfallsreichtums seines Vigoleis ab, dann eröffnet sich ein selten farbenprächtiges Bild vom Leben auf der Insel, das einem Spitzweg-Gemälde in nichts nachsteht.
Thelens Art, schreibend zu monologisieren, entwickelt eine eigene Sogwirkung, und nach fast tausend Seiten ist es fast bedauerlich, dass der Erzähler vor dem deutschen Zugriff in Spanien flieht und ins Exil geht.