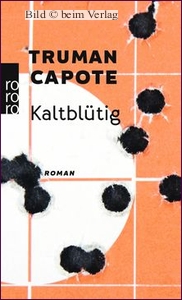 Ohne den genre-typischen Horror
Ohne den genre-typischen Horror
Mit «Kaltblütig», seinem bekanntesten Werk, hat der amerikanische Schriftstellers Truman Capote das neue literarische Genre New Journalism geschaffen, den Tatsachenroman. Darin schildert er mit den narrativen Methoden einer literarischen Erzählung den im November 1959 tatsächlich passierten, vierfachen Mord an der Familie des Farmers Clutter im Westen des US-Staates Kansas. Darauf aufmerksam geworden ist er durch einen Artikel in der Zeitschrift «The New Yorker». Er begann schon bald mit umfangreichen Recherchen zu dem großes Aufsehen erregenden Fall. Sein Buch erschien dann sechs Jahre später. Er musste sogar warten, hat er erklärt, bis die Hinrichtung der beiden Täter nach verfahrens-technischen Verzögerungen dann auch tatsächlich stattgefunden hatte. Und wer nicht vorinformiert ist als Leser, dem winkt natürlich der größte Lesegewinn, was spätestens ab dieser Stelle hier wirklich wohlmeinend zur Nachahmung empfohlen wird!
Aus wechselnden Perspektiven erzählend berichtet der Autor zunächst sehr ausführlich von der Familie Clutter, deren Oberhaupt es als strebsamer, prinzipientreuer Farmer zu einigem Wohlstand gebracht hat. Er ist als fairer Arbeitgeber bei seinen Arbeitskräften sehr beliebt und zahlt gut. Im Haus wohnen außer den Eltern die halbwüchsige Tochter Nancy und der kleine Kenyon. Zwischen die Beschreibungen der Opferfamilie wird immer wieder mal ein kurzer Schwenk zu den Tätern eingefügt, dem 28jährigen Dick und seinem 31jährigen Kumpel Perry. Die Beiden kennen sich aus dem Gefängnis, wo sie für unterschiedliche Straftaten einige Jahre eingesessen haben. Dick hat ebenfalls dort von Floyd Wells, einem Mitgefangenen, von der Farm der Clutters gehört, wo Floyd ein Jahr lang gearbeitet hat. Dort im Büro befände sich ein Tresor, der tausende von Dollars enthalten müsse, so reich wie Clutter ist. Nach ihrer Entlassung beschließen Dick und Perry, diese Farm, die sie nur aus der Erzählung kennen, nachts zu überfallen. Um nicht erkannt zu werden, wollen sie sich schwarze Damenstrümpfe über den Kopf ziehen. Die sind aber nirgendwo zu bekommen in der dünn besiedelten, ländlichen Gegend. Der Überfall findet statt, ein Tresor aber ist nicht vorhanden, denn Mr. Clutter hat aus Prinzip nie Bargeld im Haus, er zahlt immer nur mit Scheck. Als Bargeld aus den verschiedenen privaten Geldbörsen der Familie kommt letztendlich nur ein Betrag von 40 Dollar zusammen, ein Fiasko für die Verbrecher. Denn ohne Maskierung müssen sie ja alle Anwesenden als Augenzeugen töten, um unerkannt zu bleiben. Und das tun sie denn auch, absolut kaltblütig!
Die Polizei steht vor einem Rätsel, es wurden kaum Spuren hinterlassen, und es fehlt vor allem auch ein Motiv für die schrecklichen Morde, mit dem sich ein Täterkreis eingrenzen ließe. In der kleinen Ortschaft kursieren die wildesten Gerüchte, aber die Clutters waren als brave Kirchgänger überall sehr beliebt, niemand hätte einen Grund gehabt, sie alle umzubringen. Die um drei Beamte des FBI verstärkte Mordkommission bekommt nach drei Monaten plötzlich einen Tipp von Floyd Wells, der als Informant für die Tat lange gezögert hat, sich zu melden, weil er nicht mit hineingezogen werden wollte. Nun geht alles ganz schnell, die Täter werden gefasst, vor Gericht gestellt und zum Tod durch den Strang verurteilt.
Minutiös berichtet Truman Capote von der spannenden Ermittlungsarbeit, dem komplizierten Prozessverfahren, und er legt zudem geradezu sezierend die psychologischen Defekte der Täter offen, denen bis zuletzt, bis zum Galgen, aber jedes Unrechts-Bewusstsein fehlt. Auch hier gilt «Der Weg ist das Ziel», dieser journalistisch präzise erzählte Bericht ist eine bereichernde Lektüre, die so ganz ohne die genretypischen Horror-Szenarien auskommt.
Fazit: erfreulich
Meine Website: https://ortaia-forum.de
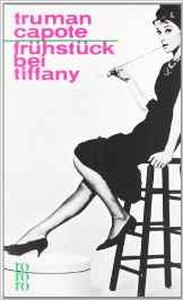 Satire auf New Yorks Schickeria
Satire auf New Yorks Schickeria