 Heraus aus Platons Höhle
Heraus aus Platons Höhle
Innerhalb seines umfangreichen Œuvres zählt «Das Zentrum» des Nobelpreisträgers José Saramago zu den besonders stark von Symbolik geprägten Romanen. Nach «Die Stadt der Blinden» und «Alle Namen» ist dies der dritte Roman des Portugiesen, den ich gelesen habe, erschienen im Jahre 2000 und damit aus der selben Schaffensperiode stammend wie die beiden anderen. Kennzeichnend für die Themen dieses Schriftstellers und auch hier die Handlung prägend ist die tiefe Humanität, die seine Geschichte ausstrahlt, seine unbeirrte Zuversicht zudem, in jedem Menschen stecke auch ein guter Kern. Trotz kafkaesk anmutender Szenen in einer menschenfeindlichen Administration gelingt es seinen Figuren, kleine Leute allesamt, sich in diesem Spannungsfeld zu behaupten, eine schützende Nische für sich zu finden und im Übrigen die Hoffnung niemals aufzugeben.
Titelgebend für den Roman ist ein molochartig wachsender Geschäftskomplex, der eine Stadt in der Stadt bildet als riesiges Einkaufszentrum einschließlich Vergnügungspark und Wohnsilo. Der verwitwete, 64jährige Töpfer Cipriano beliefert dieses Zentrum mit Tongeschirr, sein Schwiegersohn arbeitet dort als Wachmann. Mit beißender Ironie schildert Saramago die nur dem Profit verpflichteten Verhältnisse in diesem Konsumtempel, – die rüden Geschäftsmethoden, die aberwitzigen Attraktionen des Vergnügungsparks und die entmenschlicht anmutenden Bedingungen für die dort wohnenden Mitarbeiter. Ein gigantisches Plakat an der Fassade kündet von dem Geist, der da herrscht: «Wir würden ihnen alles verkaufen, was sie brauchen, wenn es uns nicht lieber wäre, sie würden alles brauchen, was wir ihnen verkaufen können.» Saramagos sarkastische Kapitalismuskritik weitet sich zu einer umfassenden Kritik der modernen Gesellschaft, wenn er die Lieferfahrten von der Töpferwerkstatt ins Zentrum schildert, vom idyllischen Dorf auf dem Lande über die trostlosen Außenbezirke mit ihren endlosen, plastiküberspannten Gemüsefeldern und den verwahrlosten Vorstadtregionen bis ins Verkehrsgetöse der unwirtlichen Großstadt.
Mit der Kündigung des Liefervertrages steht Cipriano vor dem Aus, sein Versuch, das Zentrum nunmehr mit bemalten Tonfiguren zu beliefern, scheitert ebenfalls, alle seine Mühen waren umsonst. Als dem Schwiegersohn eine Dienstwohnung im Zentrum zugewiesen wird, in die er ebenfalls mit umziehen wird, ist für ihn und seine schwangere Tochter das Töpferleben endgültig beendet. Eine später bei Erdarbeiten entdeckte, streng bewachte Höhle unter dem Zentrum erweckt seine Neugier, er steigt verbotener Weise hinab und findet dort sechs Tote. Das sind wir, erkennt er hellsichtig. Was folgt ist eine dem Höhlengleichnis von Platon entsprechende Allegorie auf den befreienden Ausstieg aus der Welt der vergänglichen Trugbilder in eine Welt des unverfälschten Seins. Er kehrt spontan in sein Haus zurück, erklärt sich endlich der ihn liebenden Nachbarin, der Schwiegersohn kündigt sein Dienstverhältnis und verlässt mit seiner Frau die gefängnisartige Wohnwabe. Alle Vier brechen auf in ein neues Leben, fahren mit dem klapprigen Lieferwagen hinaus in die Welt, einem unbestimmten Ziel entgegen.
In unnachahmlicher Weise hat der Autor seinen nachdenklich machenden Roman mit klugen Reflexionen, Andeutungen und Symbolen angereichert. Seine Figuren sind äußerst sympathisch und verblüffend lebensklug, was sich in den vielen köstlichen, nahtlos in den Erzählfluss eingebetteten Dialogen niederschlägt, die fiktiv sogar den zugelaufenen Hund mit einbeziehen. Immer wieder auch muss man schmunzeln über den feinsinnigen, hintergründigen Humor des Autors, der seinem Plot mit allerlei überraschenden Wendungen die nötige Spannung verleiht und so die Mutmaßungen des Lesers als auktorialer Erzähler schelmisch konterkariert. Der letzte Satz des Romans zitiert das neueste Plakat des Zentrums: «Baldige Eröffnung der Platonschen Höhle, Exklusiv-Erlebnis, einzigartig auf der ganzen Welt, kaufen sie jetzt ihre Eintrittskarte.»
Fazit: erfreulich
Meine Website: http://ortaia.de
 Der Reiz des Irrealis
Der Reiz des Irrealis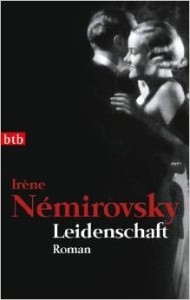 Der Schatz im Koffer
Der Schatz im Koffer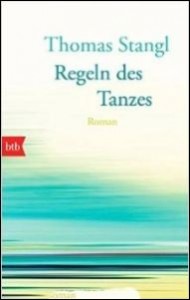 Der Froschkönig-Impuls
Der Froschkönig-Impuls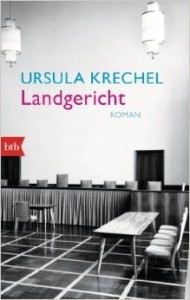 Auch posthum eine tragische Gestalt
Auch posthum eine tragische Gestalt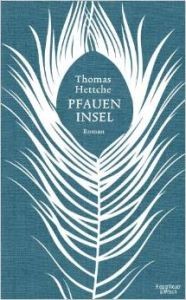 Ein leises Buch
Ein leises Buch