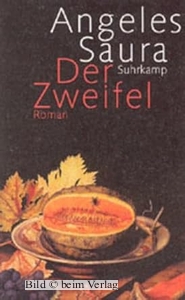 Wissenschaftlicher Super-GAU
Wissenschaftlicher Super-GAU
Der Debütroman der spanischen Schriftstellerin Ángeles Saura mit dem Titel «Der Zweifel» ist ein Kabinettstück aus der Szene der Kunsthistoriker, das tiefe Einblicke in diese akademische Disziplin bietet. Es geht um die Zuordnung eines Gemäldes aus der Barockzeit, um das ein bitterer Streit entbrennt, der tragisch endet, weil er die Existenz des Protagonisten in Frage stellt, Der nämlich hat seinen Lebenssinn in der Entdeckung und nachfolgend gründlichen Erforschung eines wenig bekannten Malers aus diese Epoche gefunden und sich damit einen weltweiten Ruf als Experte aufgebaut.
Das Lebenswerk des 84jährigen Kunstkritikers Don César Rinconeda gerät in Gefahr, als eine skandinavische Wissenschaftlerin Kontakt mit ihm aufnimmt und behauptet, das in seinem Besitz befindliche und mit F. M. signierte, lange verschollene letzte Bild «Bodegón de Ysalbos» des Barockmalers Francisco Meltán sein in Wahrheit nicht von ihm, sondern von der italienischen Malerin Fransquina Mazzanzini. Don César hatte das Bild vor 66 Jahren in einem heruntergekommenen Palazzo entdeckt und es den von seinem Wert nichts ahnenden Besitzern für lächerlich wenig Geld abgekauft. Unmittelbar nach der Kontaktaufnahme reist die Forscherin, auf seine Einladung hin, aus dem hohen Norden in die glühende Sommerhitze Kastiliens. Sie will ihm anhand von Dokumenten beweisen, dass seine Zuordnung des «Bodegón de Ysalbos» falsch ist. Der plötzlich aufgetretene, titelgebende «Zweifel» Don Césars an seiner Zuordnung ist fortan sein ärgster Feind, diese Ungewissheit bestimmt ab sofort all sein Denken und Handeln.
Ein unglaublicher Schock für ihn, denn er sieht sein ganzes Lebenswerk in Gefahr, das er ja überwiegend dem damals noch kaum bekannten Barockmaler gewidmet hat. Francisco Meltán wurde durch ihn erst in der Kunstwelt bekannt, erntete viel Anerkennung und wurde für seine ganz spezielle Malweise sogar berühmt. Anhand der vorgelegten Dokumente und Disketten der Skandinavierin wird Don César die Tragweite dieses Besuchs erst richtig bewusst, die vorgetragenen Zweifel erweisen sich als durchaus begründet. Akribisch beginnt er sofort, schriftlich einen perfekten Plan zu entwerfen, was denn genau für ihn in dieser neuen Situation zu tun bleibt, um seine wissenschaftliche Blamage zu vermeiden und sein Lebenswerk dauerhaft zu retten.
Der kammerspielartige Plot des schmalen Bändchens beschränkt sich zeitlich auf den einen Tag des Besuchs, der im Leben Don Césars mit einem Schlag alles verändert hat. Es ist zudem ein Einpersonenstück, das da konsequent in Form des Inneren Monologs erzählt wird. Man erlebt ein sprachliches und auch ein gedankliches Feuerwerk, das zuweilen an Don Quijote erinnert mit seiner Selbst-Überschätzung und Welt-Fremdheit. Genau dem ist auch Don César als Wissenschaftler zum Opfer gefallen, wie er nun entsetzt erkennen muss. Mit Monstersätzen über ganze Seiten hinweg erfordert der fast ausschließlich als innere Stimme angelegte Erzählstil des Romans, volle Aufmerksamkeit des Lesers. Zudem wird man mit einer Fülle von hochgestochenen, akademischen Fremdwörtern konfrontiert, denen man, zumal in einem Roman, kaum je schon mal begegnet ist. Ángeles Saura erzählt ihre Geschichte mit viel Witz und nicht zu übersehender, feiner Ironie. Sie beschreibt akribisch genau das Refugium des eigenwilligen Wissenschaftlers in Kastilien, sein mit allerlei Andenken und Sammlerstücken angefülltes Haus, in dem er als Witwer abgeschottet von der Welt allein lebt. In seinen Grübeleien setzt die Autorin, wie im Klappentext stimmig beschrieben, «männliche und weibliche, südlich-barocke und nordisch-aufklärerische Sicht gegeneinander». Das Ergebnis ist ein kontemplativ ungemein anregender Roman auf hohem Niveau, der fulminant von einem wissenschaftlichen Super-GAU berichtet.
Fazit: lesenswert
Meine Website: https://ortaia-forum.de