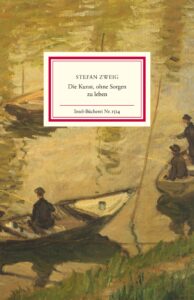 Sozusagen die letzten Worte Stefan Zweigs, eines der größten Schriftsteller unserer Zeit, werden in vorliegender Publikation nochmal zusammengetragen. Die letzten publizierten Worte erschienen zwischen 1940 bis 1942 in Zeitungen und Zeitschriften, es waren Kurzgeschichten ebenso wie politische Appelle, Warnrufe vor Katastrophen, die er nicht mehr erleben wollte.
Sozusagen die letzten Worte Stefan Zweigs, eines der größten Schriftsteller unserer Zeit, werden in vorliegender Publikation nochmal zusammengetragen. Die letzten publizierten Worte erschienen zwischen 1940 bis 1942 in Zeitungen und Zeitschriften, es waren Kurzgeschichten ebenso wie politische Appelle, Warnrufe vor Katastrophen, die er nicht mehr erleben wollte.
Die Kunst, ohne Sorgen zu leben
In der ersten, titelgebenden Erzählung, stößt Stefan Zweig beim Spaziergang mit seinem Cocospaniel Kaspar auf einen einmaligen Menschen, den Anton. Als sein Hündchen sich an Bäumen rieb und murrte und knurrte und Zweig dies erst für die “Unart des Frühlings” hielt, half ihm dieser “sonderbare Anton” indem er Kaspar den Zeck fachmännisch entfernte. Zweig, überrascht von seiner Hilfsbereitschaft, konnte gar nicht reagieren, so schnell ging dieser Anton wieder seines Weges. Zuhause erzählte Zweig von dieser Episode und seine Köchin wusste sofort Bescheid, denn jeder kannte im Salzburg von damals diesen Anton, die gute Seele. Er hatte keinen Beruf, aber ging jeden Tag spazieren und half dabei anderen Leuten, reparierte was lose, machte ganz, was kaputt. Er hätte gleichsam ein antikapitalistisches System erfunden, schreibt Zweig euphorisch, denn er nahm nie ein Geld und wollte sich nirgends bereichern. Aber alle Bewohner dieser kleinen Stadt hätten ein mobiles Kapital von moralischen Verpflichtungen ihm gegenüber angesammelt. Zweig bezeichnet dies etwas blauäugig als “großes Lebens-geheimnis“, denn er besaß zwar nichts, war aber reich, reich an sozialem Kapital. Wenn nur alle diese “Reziprozität des Vertrauens“, wie Zweig schreibt, beherzigten, dann müsste es “keine Polizei, keine Gerichte, keine Gefängnisse, kein Geld” mehr geben, so Zweig. Ein bißchen klingt das wie eine Weihnachtsgeschichte, nicht? Ein Hoch auf die Antons dieser Welt…
Im alten Österreich und der Welt
In der zweiten Geschichte, “Nur Mut!“, erfahren wir von einem Mitschüler Zweigs, dessen Vater wegen Schwindel in einem Finanzunternehmen verhaftet wurde. Zweig bereut es, damals nicht die richtigen Worte für den geknickten Mitschüler gefunden zu haben, denn er verließ die Schule und wurde Apothekerlehrling. In “Was mir das Geld bedeutet” berichtet Zweig von der grassierende Inflation, die noch weit höher war als unsere des 21. Jahrhunderts. “Ein einziges Ei kostete vier Milliarden Mark, mehr als das Etat eines Landes mit sechzig Millionen Einwohnern.” Im alten Österreich war bald jeder ein Millionär, aber nur für den Augenblick, denn eine Woche später hatte seine Million ihren Wert verloren. Unsere wirkliche Sicherheit liege aber ohnehin nicht in dem, was wir besäßen, “sondern in dem, was wir sind und was wir aus uns machen“. Und natürlich in den Menschen, die uns lieben. Die Erzählung “Die Angler an der Seine“, die auch das wunderschöne zeitgenössische Cover des vorliegenden Buches inspirierte, geht Zweig auf den Umstand ein, dass es unbeteiligte Angler gab, die nicht dem Schauspiel des welthistorischen Ereignisses, der Enthauptung König Louis in Frankreich, beiwohnten und ihm den Rücken zudrehten. “Steigert sich das Tragische ohne Maß“, schreibt Zweig, “so vermindert es die Fähigkeit, uns zu erschüttern statt sie zu steigern“. “Wir alle fühlen heute diese verhängnisvolle Proportion: Je länger das Weltdrama vor unseren Blicken dauert, umso mehr lässt unsere Fähigkeit des innerlichen Miterleben nach.”
“Die Kunst, ohne Sorgen zu leben” zeigt Zweig bei Rodin, im Nachruf auf Alfonso Hernandez Cata, und in der Trauer über ein untergehendes Europa. Aktuelle könnte kein Buch derzeit sein.
Stefan Zweig
Die Kunst, ohne Sorgen zu leben. Letzte Aufzeichnungen und Aufrufe
Mit einem Nachwort von Volker Michels. Herausgegeben von Klaus Gräbner und Volker Michels
2024, Insel-Bücherei 1524, fester Einband, 79 Seiten
ISBN: 978-3-458-19524-5
Insel Verlag, 5. Auflage
15,00 € (D), 15,50 € (A), 21,90 Fr. (CH)


