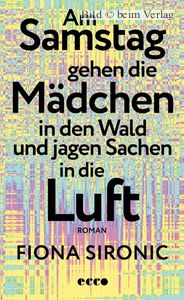 Eine Dystopie mit Wumms
Eine Dystopie mit Wumms
Der Debütroman der Schriftstellerin Fiona Sironic mit dem ellenlangen Titel «Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft» hat es auf Anhieb auf die Shortlist des diesjährigen Deutschen Buchpreises geschafft. Eines jener aktuell prämierten Bücher, wie die Juryvorsitzende anmerkte, das «in psychologische, gesellschaftliche und politische Abgründe“ blicke. Wobei der Abgrund hier die sich bereits deutlich abzeichnende Klima-Katastrophe ist. Damit gehört es zu einem neuartigen literarischen Genre, das man als realistische ‹Climate Fiction› bezeichnen kann, also als vom Klimawandel inspirierte, in der Regel dystopische Belletristik. Zu den Vorreitern dieses vieldiskutierten Genres gehört insbesondere Margaret Atwood. Eine Besonderheit des vorliegenden Romans ist der nerdige Jugendsprech, in dem er verfasst ist, ein in den asozialen Medien gebräuchlicher, hier aber auf die Spitze getriebener Kauderwelsch. Dieses geradezu archetypisch für viral gehende Texte benutzte Fachchinesisch wird für Leser, denen diese Szene fremd ist, zu einer ärgerlichen Hürde, an der nicht wenige kläglich scheitern dürften.
Der Plot ist in einer gar nicht so fernen Zukunft angesiedelt. Die fünfzehnjährige Ich-Erzählerin Era lebt mit ihrer Mutter in einer Hütte am Waldrand, sie dokumentiert dort akribisch das Aussterben vieler Vogelarten. Im Internet verfolgt sie in Echtzeit zudem aufmerksam den Stream ihrer 18-jährigen Schulkameradin Maja und deren jüngerer Freundin Merle, die auf einer Lichtung im Wald öffentlich Festplatten in die Luft sprengen. Ihre Aktion richtet sich gegen ihre Mütter, die gegen Geld als «Momfluenzerinen» dafür gesorgt haben, dass ihre gesamte Kindheit viral gegangen ist. Mit ihren ebenso radikalen wie hilflosen Zerstörungsaktionen versuchen sie nun verzweifelt, alle digitalen Spuren an ihre öffentlich gewordene Kindheit auszulöschen. Was allerdings zum Scheitern verurteilt ist, denn «das Internet vergisst nie», wie jeder weiß. Era hält alle ihre Beobachtungen und Erkenntnisse – altmodisch analog – in Notizbüchern und Zeichnungen fest, sie bildet damit einen thematischen Gegenpol zur Zerstörungswut von Maja und Merle. Was die Drei eint, das ist ihre Suche nach Intimität, sie wollen ihren Lebensraum zurück erobern. Und sie teilen das Interesse an dem fast ganz in den Hintergrund gerückten Geschehen in der realen, der analogen Welt. Während dort die Turteltaube ausstirbt, verlieben sich Maja und Era als Mädchen des Digitalzeitalters ineinander! Schließlich zerstört symptomatisch ein Waldbrand den bisherigen, noch einigermaßen intakten Lebensraum der Mädchen.
Neben den ökologischen Abgründen sind politische Bezüge in dem Roman eher vage abgedeutet. An einer einzigen Stelle wird darin als ein politischer Verweis auf «das Internet vor den Konzernen» hingewiesen, welches in der vollkommen digitalisierten Welt dann zu einem «nach den Konzernen» geworden ist. Unzählbare Streams laufen jetzt als Dauerberieselung rund um die Uhr, ein Privatleben ist quasi unmöglich geworden. Damit einhergehend hat sich eine allgemeine Kultur der permanenten Achtsamkeit entwickelt, die dazu zwingt, lückenlos über alles öffentlich Publizierte informiert zu sein.
Alle Orte dieser feministischen Geschichte sind nur vage als Land oder Stadt benannt. Die Folgen des Klimawandels sind allgegenwärtig, tropische Temperaturen fordern jede Menge Hitzetote, private Räume werden zunehmend beengter. Eras Hang zum Analogen wird im Roman von ihrer Tante als Hinweis gedeutet, sie sei dabei, zur «Sozial-Legasthenikerin» zu mutieren. Dieser Roman strotzt nur so von solcherart Neologismen als Kennzeichen eines unbeirrt eigenwilligen, «dystopischen?» Schreibstils. Seine Wirkung in der aktuellen Literatur dürfte geradezu als ein «Wumms» wahrgenommen werden, es ist keine Mahnung zum Umweltschutz mit erhobenem Zeigefinger, sondern eher mit der drohenden Faust. Darin liegt ohne Zweifel der Verdienst dieses Romans!
Fazit: lesenswert
Meine Website: https://ortaia-forum.de